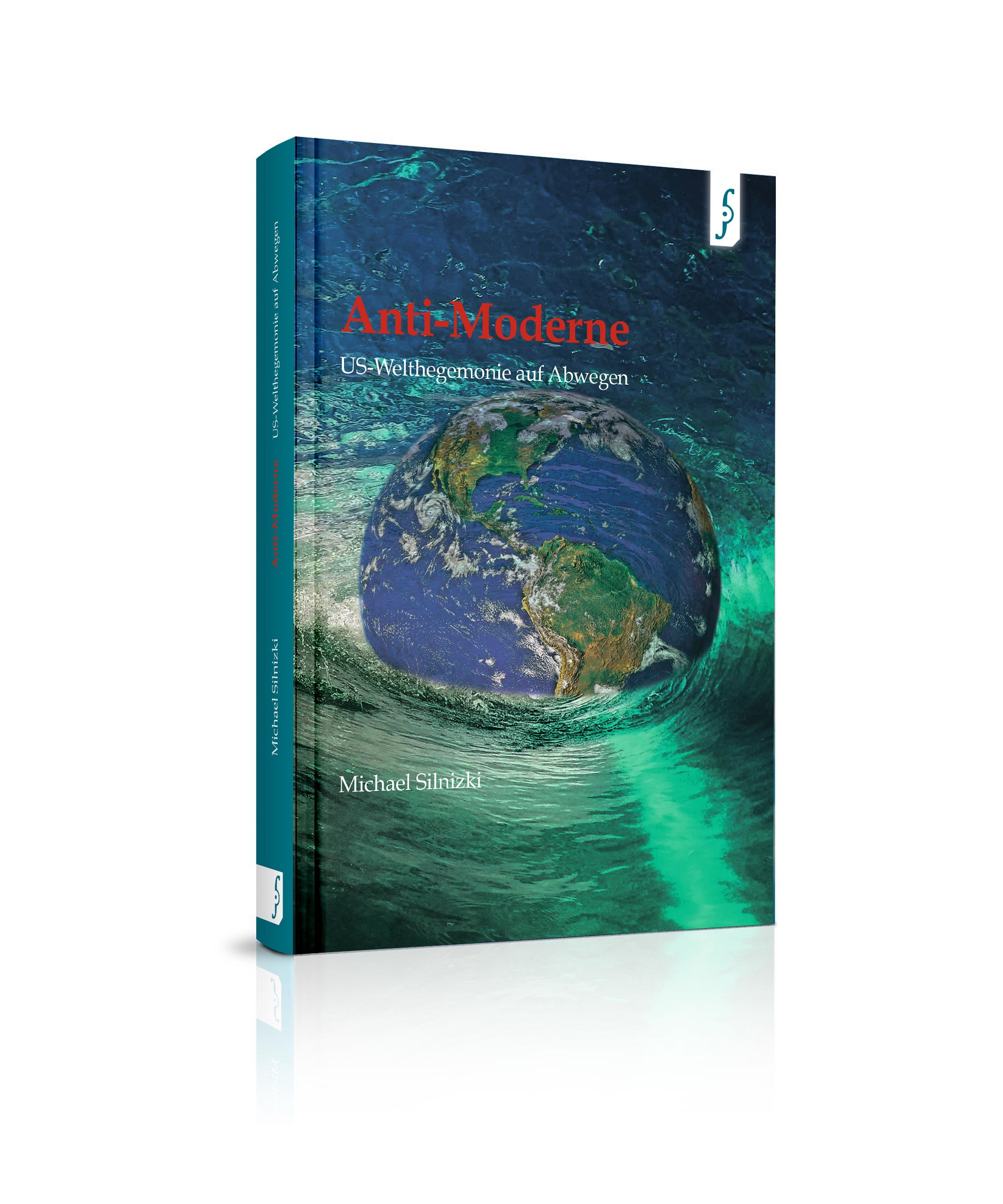Außenpolitische Fehlkalkulationen: gestern und heute
Übersicht
- „Eine Schießbude der Dilettanten“?
- Die Geburt des US-Hegemonismus aus dem Geiste des britischen Imperialismus
Anmerkungen
„Wir gehören zur angelsächsischen Rasse und wenn
ein Angelsachse etwas haben will,
nimmt er sich’s einfach.“
Mark Twain, Authobiography (1909?)
- „Eine Schießbude der Dilettanten“?
Die immer wieder gestellte Frage, ob sich die Geschichte wiederholt, stellt sich heute erneut. Wie am Vorabend des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges scheinen auch heute die europäische Außenpolitik und die US-amerikanische Welt- und Geopolitik „eine Schießbude der Dilettanten“ zu sein, wie der Schweizer Historiker, Herbert Lüthy (1918-2002), einst bei seiner Analyse der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges verächtlich formulierte.
„Dass die Epoche, die 1914 zu Ende ging, ein Zeitalter des Friedens war, ist gewiss mit einer Prise Salz zu verstehen,“ merkte Lüthy an. „Von den zwanzig Jahren vor 1914 ging kein einziges ohne größeren Krieg. … Selbst wenn man von langen und blutigen, doch als bloße Polizeioperationen nicht in Kriegsregister eingetragenen Kolonialfeldzügen absieht, … bleibt die chronologische Liste dieser zwei Jahrzehnte recht eindringlich: chinesisch-japanischer, italienisch-abessinischer, griechisch-türkischer, spanisch-amerikanischer Krieg, Burenkrieg, Boxerkrieg, russisch-japanischer Krieg, erste Marokkokrise, bosnische Annexionskrise, zweite Marokkokrise, italienisch-türkischer Krieg, erster Balkankrieg, zweiter Balkankrieg … Im Rückblick lässt sich sogar die Zündschnur verfolgen, an der das Feuer von der Abteilung Nordafrikas ins >Pulverfass< Südosteuropas hinüberlief.“1
Nichts deutete freilich darauf hin, dass diese weltweiten Kriege und Krisen, die immer wieder vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges stattgefunden haben, die Vorboten des kommenden Unheils sein würden. Vielmehr waren es die außenpolitischen Dilettanten der Donaumonarchie, welche einen Weltkrieg auslösten.
Die nunmehr seit gut zwanzig Jahren andauernden Invasions- und Interventionskriege sowie zahlreichen Krisen des noch so jungen 21. Jahrhunderts ähneln allerdings frappierend den letzten zwei Jahrzehnten vor 1914 und warnen uns davor, jenen verhängnisvollen Dilettantismus der damaligen Zeit, der zu einem solch unheilvollen Ende geführt hat, nicht mehr zu wiederholen.
Dass die unipolare Weltordnung, der die „Enttabuisierung des Militärischen“ (Lothar Brock) in den vergangenen zwanzig Jahren exzessiv auslebte, zu Ende geht, ist heute so gut wie ausgemacht. Dass die unmittelbare Zukunft uns nichts Gutes verspricht, ist es freilich nicht für jedermann klar ersichtlich. Der Kosovo-Krieg war der Auftakt einer gut zwanzig Jahre (1999-2021) andauernden Militarisierung der westlichen bzw. US-amerikanischen Außen- und Weltpolitik. Die Folgen dieser Entwicklung sind bekanntlich zahlreiche militärische Interventionen und US-Invasionen in Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen, Somalia, Syrien und nicht zuletzt ein fortwährender Drohnenkrieg überall und zu jeder Zeit in den vergangenen zwanzig Jahren.
Am Ende dieses zwei Jahrzehnte andauernden Militarisierungsprozesses steht der Krieg auf ukrainischem Boden, in dem Russland und die Nordatlantische Allianz – wenn nicht de jure, so doch de facto – einander erbittert militärisch bekämpfen. Die vorangegangenen Kriege und Krisen erklären jedoch genauso wenig, warum Europa 1914 unbedingt in den Ersten Weltkrieg stürzen musste, wie die militärische Konfrontation zwischen Russland und der Nato auf ukrainischem Boden zwangsläufig einen Weltkrieg auslösen sollte.
So verfahren die außen- und innenpolitische Lage der Donaumonarchie am Vorabend des Kriegsausbruchs war, so wenig war sie katastrophal, hoffnungslos und friedensgefährdend. Keine der Großmächte wünschte 1914 den Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie. Und es „gab nichts am österreichisch-serbischen Konflikt, was für die europäische Diplomatie schwieriger zu bewältigen gewesen wäre als Dutzende anderer Konflikte, die ihm vorausgegangen waren.“2
Der Erste Weltkrieg brach dennoch aus und es waren neben den außenpolitischen vor allem innenpolitische Gründe, die einen Weltkrieg auslösten:
1.Die Ideologie des Herrenmenschentums und die Nationalitätenkonflikte innerhalb der Donaumonarchie, „für deren >Unlösbarkeit< nicht die serbische Regierung oder Propaganda verantwortlich war, sondern der verfassungsmäßig verankerte Herrenvolkanspruch des ungarischen Feudalstaates.“ Daraus entstand ein Konflikt zwischen der Annexionslust des Generalstabschefs Conrad von Hötzendorf, „der seit Jahren die gewaltsame Einverleibung Serbiens … forderte und dem Veto des ungarischen Ministerpräsidenten Tisza, der … jede Vermehrung der slawischen Untertanenbevölkerung als Bedrohung der ungarischen Vormacht ablehnte“ (ebd., 280 f.).
Tiszas Geisteshaltung ist geradezu paradigmatisch für das Zeitalter des europäischen Imperialismus und Rassismus. So warf Wilhelm II. noch anderthalb Jahre vor dem Kriegsausbruch England „Rassenverrat“ vor und „ein Parteigänger der Gallo-Slaven gegen die Germanen!“ zu sein: „Das richtige Krämervolk!“, empörte er sich. „Der Endkampf der Slaven und Germanen findet die Angelsachsen auf Seiten der Slaven u. Gallier.“3
2.Die Erteilung einer Lektion: Die Folge dieser Auseinandersetzung innerhalb der Donaumonarchie war letztlich das Bestreben, den österreichisch-serbischen Konflikt wenigstens mittels einer „Strafexpedition um der Strafexpedition willen“ zu lösen, um „eine Lektion zu erteilen“, um „mit Serben abzurechnen“ oder – wie Kaiser Franz Joseph am 5. Juli 1914 an Kaiser Wilhelm schrieb, um „Serbien als politischen Faktor am Balkan auszuschalten“.
3.Die bewusste Torpedierung einer friedlichen Konfliktregelung: Die vom Ministerpräsident Berchtold dem Kaiser zur Unterschrift vorgelegte Kriegserklärung an Serbien begründete diese Vorgehensweise damit, dass die Großmächte sonst „noch den Versuch machen könnten, eine friedliche Beilegung des Konflikts zu erreichen, wenn nicht durch eine Kriegserklärung eine klare Situation geschaffen wird“.4
Die Gefahr einer friedlichen Beilegung des Konflikts, der vier Wochen nach dessen Ausbruch längst zur europäischen Angelegenheit geworden war, war so groß, dass selbst Kaiser Wilhelm am Morgen der österreichischen Kriegserklärung beim verspäteten Lesen der serbischen Antwort nicht mehr begriff, was Österreich eigentlich noch wollte. „Damit fällt jeder Kriegsgrund weg!“, wunderte er sich.
Und „es war höchste Zeit, wenigstens durch ein Aktenstück eine >unwiderrufliche Tatsache< zu schaffen, die alle weiteren … >hinfällig machte<; sodass noch in den finsteren Morgenstunden des 30. Juli, als in Petersburg schon Mobilisationsbefehle geklebt wurden, der deutsche Botschafter dem russischen Außenminister nichts anderes als die hanebüchene Antwort geben konnte, die Feindseligkeiten seien nun einmal ausgebrochen und >beim Friedensschluss werde es immer noch Zeit sein, auf Schonung der serbischen Souveränität zurückzukommen<.“5
Die Donaumonarchie wollte lediglich eine „Strafexpedition“ durchführen, bekam aber stattdessen einen Krieg – den Ersten Weltkrieg. Aus einer als „Strafexpedition um der Strafexpedition willen“ vorgestellten Aktion ist ein grausamer und erbarmungsloser Weltkrieg geworden. Am Anfang der europäischen Tragödie standen nicht so sehr zahllose Kriege und Krisen der vorangegangenen zwei Jahrzehnte als vielmehr rassenideologische Ressentiments, innenpolitische Friktionen und nicht zuletzt die Bereitschaft zu einer militärischen Konfrontation beinahe um jeden Preis.
Wie ähneln sich doch die Ereignisse von gestern und heute. Vor dem Hintergrund des tobenden Ukrainekrieges müsse man Russland – hört man allerorts – ein für alle Mal „eine Lektion erteilen“. „Eine strategische Niederlage zufügen“ nennt sich heute diese „Lektion“. Als Ende März/Anfang April 2022 ein unterschriebener Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung der am 24. Februar ausgebrochenen Kriegshandlungen vorlag, da reiste der ehem. Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson, am 9. April 2022 unangekündigt nach Kiew, um den ausgehandelten Friedensvertrag mit tatkräftiger Unterstützung der USA erfolgreich zu torpedieren.
Die Angelsachsen wollten statt eines Friedensvertrags die Fortsetzung des Krieges und „basta!“, wie der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu sagen pflegte. Sie witterten Morgenluft, um Russland „eine Lektion zu erteilen“, um Putin eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, um den ewigen geopolitischen Rivalen ein für alle Mal ökonomisch, technologisch und monetär auszuschalten. Ein Dollar würde bald 200 Rubel wert sein, jubelte Joe Biden kurz nach dem Kriegsausbruch.
Was für ein Dilettantismus der angelsächsischen Machteliten! Spätestens nach Johnsons Besuch nahm dieser an sich regionale Konflikt zwischen den zwei ostslawischen Brüdervölkern eine verhängnisvolle geopolitische Dimension an, der zur indirekten militärischen Konfrontation zwischen Russland und den Nato-Staaten unter Federführung des US-Hegemonen geführt hat. Wenn etwas untergehen will, ist es nicht mehr aufzuhalten! Und so schlittert der Westen unter Führung der Angelsachsen immer mehr und immer tiefer in diesen Konflikt hinein, den er unmöglich gewinnen, aber alles verlieren kann.
„Hochmut kommt vor dem Fall“ (Kaiser Wilhelm II. zu einem Bericht des Botschafters in Petersburg vom 13. Juli 1914). Die angelsächsischen Dilettanten hatten nur nicht damit gerechnet, dass sie nämlich selbst mit ihrer Entscheidung, den Krieg „bis zum letzten Ukrainer“ (Boris Johnson) weiter zu führen, in eine Sackgasse geraten könnten. Denn der ökonomische Blitzkrieg gegen Russland ist gescheitert! Der fortdauernde Sanktionskrieg ist bis dato ebenfalls gescheitert! Die am 4. Juni 2023 gestartete sog. Gegenoffensive der Ukraine blieb bis jetzt erfolglos. Das einzige Ergebnis sind kolossale Verluste von Menschenleben und an vom Westen gelieferte Waffen.
Und was nun? Wie die skizzenhaft dargestellte historische Parallele der Ereignisse von gestern und heute zeigt, ist die westliche bzw. US-amerikanische Anti-Russlandpolitik im besten Falle ein blinder Marsch ins Nichts und im schlimmsten Falle eine Gefährdung des Weltfriedens.
2.Die Geburt des US-Hegemonismus aus dem Geiste des britischen Imperialismus
Die USA haben sich nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches und der bipolaren Weltordnung zu der unangefochtenen globalen Hegemonialmacht entwickelt, deren Weltdominanz zur Entstehung einer unipolaren Welt geführt hat. Den Grundstein für diese Unipolarität legte bereits die Clinton-Administration mit ihrer Entscheidung für eine expansionistische Außen- und Weltpolitik.6 Dass eine solche weitreichende Entscheidung ausgerechnet Bill Clinton getroffen hat, hat einen tiefen ideen- und realgeschichtlichen Hintergrund.
Clinton war ein gelehriger Schüler eines US-amerikanischen Zivilisationstheoretikers, Carroll Quigley (1910-1977). In seiner Rede zur Annahme der Präsidentschaftskandidatur nannte Clinton „Quigley neben John F. Kennedy jenen Menschen, der seinen politischen Idealismus am tiefsten beeinflusst hat. Clinton war Mitte der sechziger Jahre Student bei Quigley in Georgetown (Washington D. C.) gewesen, zu einer Zeit, als Quigley gerade an seinem Hauptwerk Tragedy and Hope … arbeitete.“7
In seinem umfangreichen, knapp 1000 Seiten umfassenden Werk „Tragödie und Hoffnung“ vertritt Quigley die kühne These, dass die Fähigkeit der westlichen Zivilisation, „die anderen Kulturen zu zerstören“, auf einer dauerhaften Expansion beruhe. Die westliche Zivilisation habe „drei Perioden der Expansion“ durchlaufen und wäre „drei Mal in eine Konfliktphase“ geraten. In der Konfliktphase bildete sich immer wieder „eine neue Organisation der Gesellschaft, die aus ihrer eigenen organisatorischen Kraft heraus expandieren konnte.“8
Die Geschichte der westlichen Zivilisation sei nach Quigley ein ständiger Wechsel zwischen Expansions- und Konfliktphase, die sich gegenseitig ablösen und bedingen. Die vier Etappen der Konfliktphase (Abnahme der Expansionsdynamik, Klassenkonflikte, imperialistische Kriege, Irrationalität) würden nach und nach und immer wieder durch die vier für die Expansionsphase typischen Phänomene (demographische und geographische Ausdehnung, Steigerung von Produktion und Wissen) substituiert.
Der Übergang von einer Konflikt- in eine Expansionsphase führe genauso zu einer erneuten Investition und Kapitalakkumulation, wie der Übergang von einer Expansions- in eine Konfliktphase den Rückgang der Investitionen und die Abnahme der Kapitalakkumulation mit sich bringe.9 Folgt man dieser Zivilisationstheorie von Carroll Quigley, so erscheint die fortschreitende Entwicklung des „Westens“ als eine ökonomische Veranstaltung, die den ökonomischen Gesetzen von Aufschwung und Abschwung, Boom and Bust, folgt.
Quigleys Zivilisationstheorie nimmt nicht nur den berühmt gewordenen Slogan der Wahlkampagne Clintons: „It´s the economy, stupid!“ bereits vorweg, sondern prägt im Wesentlichen auch seine Russland- bzw. Außenpolitik im postsowjetischen Raum, in deren Zentrum die Nato-Expansionspolitik steht. Nach der „Konfliktphase“ des „Kalten Krieges“ tritt die westliche Zivilisation – folgt man Quigleys Lehre – erneut in das „Zeitalter der Expansion“ ein. Diese neue Expansionsphase, die zur demographischen und geographischen Ausdehnung der westlichen Zivilisation und damit zum Wohlstand und Prosperität aller Nationen führen sollte, löste die Konfliktphase der bipolaren Weltordnung ab und verwandelte diese in die Expansionsphase der Unipolarität.
In dieser erneuten Expansionsphase muss der postsowjetische Raum als eine „außenstehende Zivilisation“ (Quigley, ebd., 21) vom Westen „zivilisiert“ und das heißt: kolonisiert werden, um so seine ökonomische Rückständigkeit im Sinne der Errungenschaften der westlichen Zivilisation überwinden zu können. Zur Abfederung dieses Zivilisierungs- bzw. Demokratisierungsprozesses bedürfe es zwingend einer Nato-Osterweiterung.
Quigleys Zivilisationstheorie nimmt jene Tendenzen der US-amerikanischen Außen- und Weltpolitik vorweg, die von Clinton in die Wege geleitet wurden und bis heute die US-Außenpolitik maßgeblich prägen und zur Fetischisierung der US-Expansionspolitik geführt haben. Der prominenteste Vertreter und Protagonist dieser expansionistischen US-Außenpolitik war Clintons engster Freund und US-Vizeaußenminister Nelson Strobridge „Strobe“ Talbott (1993-2001).
Talbott war genauso wie Clinton ein Stipendiat der Rhodes-Stiftung, deren Gründer kein geringerer als Cecil Rhodes (1853-1902) – einer der markantesten Vertreter des britischen Imperialismus – war und der die Expansion zum höchsten Wert und Ziel des British Empire erhoben hat. „Expansion is everything. … I would annex the planets if I could,“ verkündete er einst unumwunden.10
Der Rhodes Trust ist eine Elitekader-Institution – eine Stiftung, deren wichtigste Aufgabe „in der Finanzierung der Rhodes-Stipendien“ bestand und besteht, „mit denen jedes Jahr zwölf sorgfältig ausgewählte Studenten vor allem aus den englischsprechenden Ländern die Mittel zu einem Studium in Oxford erhalten. Diese Rhodes-Stipendien haben von Beginn an dazu gedient, eine Art Elite für die weltgespannten Pläne von Rhodes und Milner heranzuziehen.“11
Nach Rhodes´ Tod wurde Lord Milner (1854-1925) zu wichtigstem Verwalter und treibender Kraft der Stiftung. Alfred Milner gehörte nach Überzeugung von Hans-Christoph Schröder „zu den führenden Imperialisten Englands im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert“ und wurde „nach seiner Tätigkeit als Hoher Kommissar in Südafrika und seiner Rückkehr nach England im Jahre 1905 geradezu als >Symbol des britischen Imperialismus< betrachtet.“12
Ausgerechnet unter Milner wurde die Rhodes-Stiftung „in den folgenden Jahrzehnten zu einer der bedeutendsten Kräfte in der englischen und Weltpolitik.“13 Mit außerordentlich weitreichenden Vollmachten in Südafrika ausgestattet, errichtete er nach Ausbruch des Burenkrieges (1899-1902) die britischen Konzentrationslager. Bis zu 160.000 Menschen wurden darin inhaftiert. Unter dem Eindruck der Nachrichten über diese Konzentrationslager im Juni 1901 unterzog der Führer der Liberalen Partei Sir Henry Campbell–Bannerman (1836-1908) die Vorgehensweise der britischen Armee mit seiner berühmten „methods of barbarism“-Rede einer heftigen Kritik.
Allein die Gruppe der „Liberalen Imperialisten“ um Asquith, Grey und Haldane bekannten sich „voll zu Milner und verteidigte die Internierungslager in Südafrika als militärische Notwendigkeit“.14 Was zu Zeiten des British Empire „Liberale Imperialisten“ hießen, heißen heute in Zeiten der US-Hegemonie „liberale Internationalisten“. Selbst die Terminologie hat sich seitdem kaum geändert. Der Geist des „liberalen Imperialismus“ bzw. „Internationalismus“ hat die US-Machteliten bis dato voll im Griff.
Freilich konnten die sog. „Liberalen Imperialisten“ ihre Herrschaft über Liberale Partei nicht erringen, scheuten aber letztlich vor einem klaren Bruch mit der eigenen Partei zurück und traten sogar bei der Regierungsbildung im Dezember 1905 „ohne irgendwelche Bedingungen in das Kabinett des Milner so verhassten Campbell-Bannerman ein.“15
Milners und der „Liberalen Imperialisten“ Kritik an der – wie Schröder es paradox formulierte – „Systemlosigkeit des >Systems<“ drehte sich im Wesentlichen um „imperiale Fragen“. Denn im Zentrum seiner Weltanschauung steht das Wohl und Wehe des Imperiums und sonst gar nichts. Milners Hauptkritik des englischen Parlamentarismus besteht deswegen darin, „dass Parlamentarier, die zumeist nach rein >lokalen< Gesichtspunkten gewählt worden waren, über die Geschicke des Empire zu entscheiden hätten. … Der Parlamentarismus musste in Milners Sicht seiner Natur nach wegen der angelegten Tendenzen zum Kompromiss … stets zur Verwässerung und Verschlechterung einer richtigen, >nationalen< Politik führen.“16
Milners Kritik am Parlamentarismus und Parteiwesen beruhte auf seiner imperialen Überzeugung, „dass Parteiinteressen und >nationales Interesse< einander diametral entgegengesetzt seien … Imperiale Fragen waren zu wichtig, um sie den Parteien zu überlassen“ und „Englands Existenz zu sichern.“17 Das Nationale sei Milners imperialistischer Gesinnung zufolge imperial fundiert.
Damit spricht Milner ein hoch brisantes Thema der Inkongruenz zwischen Nationalem und Imperialem an, indem er unbewusst die ganze Dysfunktionalität eines „Systems“ hinterfragt, welches das Imperiale und das Nationale in Einklang bringen möchte, um so das Unvereinbare zu vereinbaren, was an und für sich ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Denn die „Systemlosigkeit des Systems“ bestand gerade darin, dass die nationalstaatlichen, parlamentarisch legitimierten Entscheidungsprozesse unmöglich in Einklang mit der Tätigkeit einer durch parlamentarische Organe kaum kontrollierten, selbstherrlich und nahezu uneingeschränkt handelnden bürokratisch-autoritären Empire-Verwaltung gebracht werden konnten.
Das war aber nicht so sehr eine „Systemlosigkeit des Systems“ als vielmehr zwei heterogene und sich selbst ausschließende Machtstrukturen, die in ein und demselben Staatswesen zusammen bestehen mussten. Bereits Hannah Arendt hat diese innerstaatliche Dysfunktionalität der politischen Institutionen klar erkannt, indem sie feststellte, dass Nationalstaat und Empire, Parlamentarismus und Imperialismus, Nation und Expansion, welche die Neuzeit aus sich heraus hervorbrachte, im Grunde zwei unvereinbare, sich selbst ausschließende politische Ideenkreise sind.
„Expansion als beständiges und höchstes Ziel aller Politik ist die zentrale politische Idee des Imperialismus“, wohingegen die Nation „keine Reiche gründen (kann)“, weil im „Falle der Eroberung … dem Nationalstaat nichts übrig(bleibt), als fremde Bevölkerungen zu assimilieren und ihre >Zustimmung< zu erzwingen“. „Daher besteht“ – fügt Hannah Arendt entrüstet hinzu -, „wenn er Eroberungen macht, stets die Gefahr der Tyrannis“.18
Was gestern das Problem des British Empire war, ist heute längst zum Problem der US-Hegemonie geworden. Denn in dieser dichotomischen Gegenüberstellung einer demokratisch-parlamentarischen Willensbildung und einer in der Außenwelt selbstherrlich und machtmissbräuchlich agierenden Empire-Verwaltung zeigt sich das gleiche Dilemma auch der US-Hegemonie von heute.
Getreu Rhodes´ Credo: „Expansion is everything“, Milners Vermächtnis und Carroll Quigleys Zivilisationstheorie konzipierte Talbott die expansionistische US-Geostrategie im eurasischen Raum, in deren Mittelpunkt die Nato-Osterweiterung stand.
Auf Vorschlag von Talbott übte Clinton Druck auf Boris Jelzin aus, die „NATO’s expansion“ zu akzeptieren und im Gegenzug „Moscow’s participation in the Partnership for Peace“ als „NATO-lite“ anzubieten, um die russischen Bedenken zu zerstreuen.
Wie zu erwarten war, stieß Clintons Vorhaben auf einen heftigen Widerstand der russischen Seite. Und so berichtete Talbott Clinton in einem Memorandum, dass „virtually all major players in Russia, all across the political spectrum, are either deeply opposed to, or at least deeply worried about, NATO expansion.“19
Vor diesem ideengeschichtlichen und realhistorischen Hintergrund wird deutlich, dass die Clinton-Administration ihre Außen- bzw. Russlandpolitik in Anlehnung an den Geist und die Tradition des britischen Imperialismus konzipierte. Der Geist der expansionistischen Machtpolitik des British Empire wirkt im US-Machtestablishment nach und ist bis heute allgegenwärtig. Der Ukrainekonflikt zeigt uns heute, dass die von der Clinton-Administration um die Mitte der 1990er-Jahre in die Wege geleitete und von den nachfolgenden US-Administrationen fortgesetzte expansionistische Hegemonialpolitik nicht mehr, sondern weniger Frieden und Sicherheit in Europa gebracht hat.
Solange die transatlantischen Machteliten das nicht begreifen (wollen), bleibt Europa für unabsehbare Zeit ein Pulverfass, das den Weltfrieden in Gefahr bringt.
Anmerkungen
1. Lüthy, H., Das Ende einer Welt: 1914, in: ders., In Gegenwart der Geschichte. Historische Essays. Köln Berlin 1967, 271-310 (277).
2. Lüthy (wie Anm. 1), 280.
3. Zitiert nach Lüthy (wie Anm. 1), 293.
4. Lüthy (wie Anm. 1), 280 ff.
5. Lüthy (wie Anm. 1), 282.
6. Vgl. Silnizki, M., George F. Kennan und die US-Russlandpolitik der 1990er-Jahre. Stellungnahme zu Costigliolas „Kennan’s Warning on Ukraine“. 7. Februar 2023, www.ontopraxiologie.de.
7. Bracher, A., „Das anglophile Netzwerk“ – Carroll Quigleys Enthüllungen zur anglo-amerikanischen Politik, in: ders., Europa im amerikanischen Weltsystem. Bruchstücke zu einer ungeschriebenen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Basel 2001, 19-47 (19).
8. Quigley, C., Tragödie und Hoffnung. Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit. Rottenburg 2016, 19 f.
9. Vgl. Quigley (wie Anm. 8), 20.
10. Zitiert nach Arendt, H., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München Zürich 1967, 218.
11. Bracher (wie Anm. 7), 24.
12. Schröder, H.-C., Imperialismus und antidemokratisches Denken. Alfred Milners Kritik am politischen System Englands. Wiesbaden 1978, 11f.
13. Bracher (wie Anm. 7), 24.
14. Schröder (wie Anm. 12), 24.
15. Schröder (wie Anm. 12), 25.
16. Vgl. Schröder (wie Anm. 12), 33 ff.
17. Schröder (wie Anm. 12), 38 f.
18. Arendt, H., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Bd. II: Imperialismus. Frankfurt/Berlin/Wien 1975,19.
19. Zitiert nach Silnizki (wie Anm. 6).