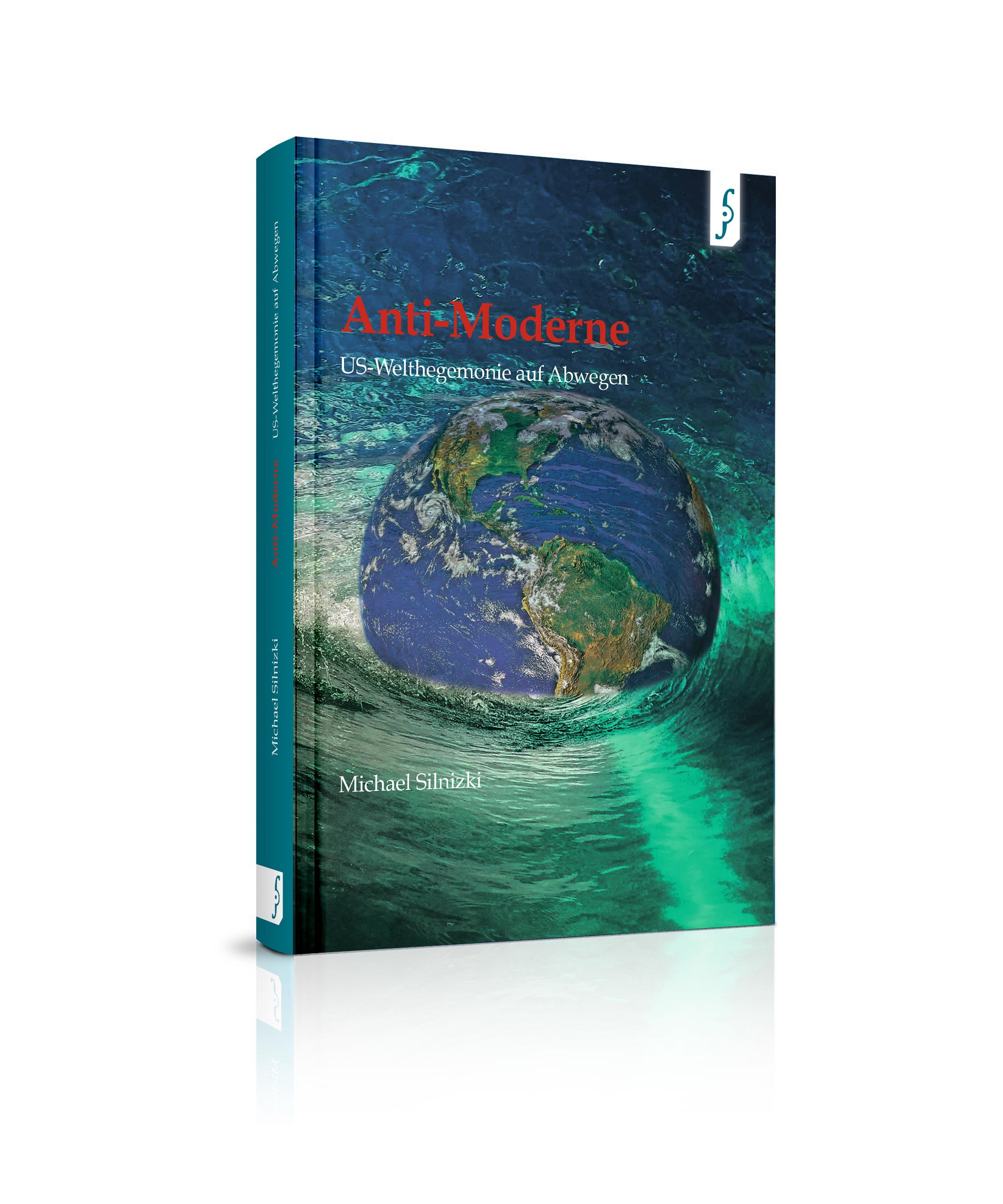Zur Sicherheitskonstellation von heute und morgen
Übersicht
1. Wie im „Kalten Krieg“?
2. Geopolitik über alles?
3. Was wäre, wenn …?
4. Wie geht es weiter?
Anmerkungen
„Man wollte die natürliche Föderativverfassung von Europa
so organisieren, dass jedem Gewicht in der großen
politischen Masse irgendwo ein Gegengewicht
zusagte.“
(Friedrich von Gentz)1
1. Wie im „Kalten Krieg“?
„Man war von der Annahme ausgegangen“ – schrieb der französische Kriegstheoretiker Raymond Aron inmitten des ausgebrochenen „Kalten Krieges“ und gegen Ende des Koreakrieges 1953 -, „dass man eine Art Krieg im Frieden haben werde … oder aber einen totalen Krieg … Nun stand man einem dritten Fall gegenüber, den niemand vorausgesehen hatte, nämlich dem Krieg auf einem begrenzten Kriegsschauplatz.“2 Gemeint war der Krieg in Korea (1950-1953).
Befinden wir uns mit dem Krieg in der Ukraine in einer vergleichbaren Situation? Stehen wir heute ebenfalls „einem dritten Fall gegenüber“? Nicht ganz! Der Ukrainekrieg ist eine Zeitenwende in einer nie enden wollenden ideologischen und geopolitischen Rivalität zwischen Russland und Europa. Sie beendet heute abrupt die europäische Sicherheits- und Friedensordnung, die nach dem Ende des Ost-West-Konflikts von der NATO-Osterweiterung geprägt und vom US-Hegemon als der Ordnungsmacht in Europa dreißig Jahre lange dominiert wurde. Der Ukrainekrieg stellt zugleich das nach dem Ende des „Kalten Krieges“ entstandene Machtungleichgewicht als europäisches Ordnungsprinzip der US-Hegemonialmacht in Frage.
Bedeutet diese Zeitenwende, dass die USA dabei sind, ihre Führungsrolle in Europa zu verlieren? Die Frage kann noch nicht abschließend beantwortet werden. Ihre Beantwortung hängt davon ab, wie der Ukrainekrieg ausgeht. Immerhin führt der Krieg uns vor Augen, dass weder die USA noch die EU oder die NATO-Allianz eine gesamteuropäische Sicherheits- und Friedensordnung gewährleisten konnten. Denn es tobt ein Krieg in Europa und sie konnten ihn nicht verhindern. Ohne die Einbeziehung Russlands in die gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur kann es darum keinen Frieden mehr in Europa geben.
Ohne Beachtung der russischen Sicherheitsinteressen bekommen wir im besten Falle eine Reanimierung des „Kalten Krieges“ – einen „Krieg im Frieden“ -, im schlimmsten Falle „einen totalen Krieg“. Wir befinden uns momentan in der Gefahrenzone einer permanenten Konfrontation, deren Eskalationspotential sich aus westlicher Sicht erst dann erschöpft, wenn Russland entweder kapituliert oder seine Außen- und Sicherheitspolitik durch ideologische und/oder innerpolitische Umwälzungen radikal verändert. Darauf sollte der Westen aber lieber nicht setzen. Das Jahr 1991 wird sich nicht wiederholen, selbst wenn der Westen versuchen würde, Russland in Europa dauerhaft monetär und handelspolitisch zu isolieren, vor der ganzen Weltöffentlichkeit medial an den Pranger zu stellen und moralisch zu delegitimieren.
Denn der globale Raum ist auf dem besten Wege, sich vom Westen zu emanzipieren. Die EU-Europäer wollen das immer noch nicht wahrhaben. Sie glauben immer noch die ganze Welt belehren zu können, was moralisch geboten, geopolitisch verwerflich und völkerrechtlich rechtens sei. Dieser Eurozentrismus hat sich überlebt und längst in EU-Eskapismus verwandelt, sodass ein neuer wie zu Zeiten des „Kalten Krieges“ ideologisch, technologisch und ökonomisch gezogener „Eiserner Vorhang“
von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Statt davon zu träumen, Russland ökonomisch zu destabilisieren oder gar zu „ruinieren“ (Annalena Baerbock), sollten die EU-Europäer sich lieber über eine neue Sicherheitskonstellation in Europa Gedanken machen, bevor es zu spät ist. Und sollte der Westen Russlands Warnungen nicht ernst nehmen, kann es tatsächlich zu spät sein.
Russland ist heute wie ein verwundeter Sibirischer Braunbär, der in die Ecke getrieben wird, gefährlich, ja sehr gefährlich und sogar gefährlicher als zurzeit des Ost-West-Konflikts, und zwar nicht weil es stark, sondern weil es schwach ist. Zwar sei Russland – wie das bekannte Bonmot suggeriert – niemals so schwach, wie man denkt, und niemals so stark, wie es droht. Seine Warnungen und Mahnungen können nicht ignoriert, sondern müssen ernst genommen werden.
Wer im Jahre 2022 die Augen offen hält, muss erkennen, dass der Krieg in der Ukraine eine neue Periode der Unsicherheit, Instabilität und Unruhe in Europa eingeleitet hat. Es wird schwer, ja beinahe unmöglich sein, die Sicherheits- und Friedensordnung herzustellen, die vor dem 24. Februar 2022 existierte. Denn dieses Sicherheitskonstrukt beruhte auf einem nach dem Ende des „Kalten Krieges“ entstandenen und ausgebildeten Machtungleichgewicht als sicherheitspolitisches Ordnungsprinzip der US-Hegemonialmacht. Es war von Anfang an auf Dauer nicht tragfähig und letztlich zum Scheitern verurteilt, weil ihm die Instabilität und Inkongruenz immer schon inhärent war. Nunmehr wird es von Russland mit dem Ukrainekrieg offen und unmissverständlich in Frage gestellt.
Noch weiß niemand, wie die Sicherheitskonstellation im Europa von morgen aussehen wird. Man muss allerdings befürchten, dass die Eskalationsspirale weiter geht und die geopolitische Rivalität noch lange nicht ihr Limit ausgeschöpft hat. Wenn die gegenwärtige Krise ihren Grund allein in einem innerslawischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hätte, hätte man hoffen dürfen, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet würde. Dem ist aber leider nicht so. In Europa entsteht gerade ein sicherheitspolitisches Vakuum, das gefüllt werden möchte. Aber wie? Das weiß heute noch keiner.
Selbst die US-Geostrategen, die immer und immer wieder schnell dabei sind, >Gott und die Welt< zu belehren, sind auf einmal ratlos. Nur Waffenlieferungen? Allein die russische Führung als „Kriegsverbrecher“ anzuprangern und über „Genozid“ am ukrainischen Volk zu schwadronieren? Das ist herzlich wenig. Es fehlt eine handfeste und zukunftweisende Sicherheitsstrategie – eine positive Agenda, welche das Kriegsgeschehen in eine für alle Seiten zufriedenstellende Friedenstrategie umwandelt. Aber wollen die US-Strategen das überhaupt? Ist das nicht das erklärte Ziel der Biden-Administration, die Russen zu schwächen und den Krieg buchstäblich „bis zum letzten Ukrainer“ in die Länge zu ziehen? Wenn das so ist, was wird dann von der Ukraine noch übrigbleiben?
Man stößt immer wieder auf das gleiche Hindernis, wenn man versucht, eine gesamteuropäische Sicherheitskonstellation zu entwerfen, nämlich die Weigerung der USA ihre seit dreißig Jahren andauernde Hegemonialstellung in Europa zur Disposition zu stellen und das Machtungleichgewicht zu revidieren. So wie die Dinge heute liegen, kann man zu einer neuen Sicherheitskonstellation in Europa auf dem Wege entweder über einen Krieg „auf einem begrenzten Kriegsschauplatz“ wie in der Ukraine oder über einen gesamteuropäischen Krieg kommen, durch den eine von beiden geopolitischen Rivalen ausgeschaltet würde. Kann es überhaupt zu einem solchen Krieg kommen? Und wird er sich nicht über die Grenzen Europas hinaus ausweiten (können)?
Eine solche Entwicklung darf zumindest nicht ausgeschlossen werden, zumal „der Westen zu keinem Kompromiss, Russland (aber) zu keiner Kapitulation bereit ist“ (Dmitrij Trenin). Die USA sind darüber hinaus ebenso wenig gewillt, auf ihre weltweite Vormachtstellung wie auf ihre Gestaltungsmacht in Europa zu verzichten. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir erneut – und sei es ungewollt – den der Menschheit so vertrauten Weg auf Kosten von Millionen und Abermillionen von Menschenleben nochmals gehen werden. Wenn weder Kompromiss noch Kapitulation möglich ist und weder eine Friedensstrategie noch eine alle Seiten zufriedenstellende gesamteuropäische Sicherheitsordnung wünschens- und erstrebenswert ist, dann gibt es nur einen bellizistischen Ausweg.
Wir haben uns dreißig Jahre lang eingebildet, dass es trotz der um uns herumtobenden Kriege mit hunderttausenden von Opfern und mit unserer tatkräftigen Beteiligung keinen Krieg im „zivilisierten Europa“ geben könne. Weit gefehlt, wie man sieht! Wir haben den Umstand ignoriert und/oder außer Acht gelassen, dass ein Mächteungleichgewicht in Europa nur vorübergehend bestehen kann und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Russland diese Ungleichgewichtskonstellation in Frage stellt, gegen den sicherheitspolitischen Status quo aufbegehrt und zu revidieren versucht.
Die Macht des Status quo und die Revisionsmacht, Hegemonie- und Gleichgewichtsstreben prallen hart und unversöhnlich aufeinander und das Ergebnis dieses Aufpralls lautet hier und heute der Krieg in der Ukraine. Kommt es zur Ausweitung dieses blutigen Ereignisses auf ganz Europa? Das hängt davon ab. Der Aufprall der antagonistischen Machtinteressen begründet auf jedem Falle eine prekäre Dynamik, die infolge einer unkontrollierten Eskalationsspirale entgrenzt werden könnte.
Der „Kalte Krieg“ – meinte Raymond Aron – war „ein begrenzter Krieg, nicht weil der Kampfpreis beschränkt wäre, sondern weil die Kriegsführenden im stillschweigenden Einvernehmen darauf verzichten, alle Mittel der Kriegsführung, die sie besitzen, zum Einsatz zu bringen.“3 Die geopolitische Krise der Gegenwart ist insofern gefährlicher und unberechenbarer, als 1. ihr kein „Gleichgewicht des Schreckens“ zugrunde liegt bzw. eine Ungleichgewichtsstruktur inhärent ist und 2. kraft des Geo-Bellizismus4 entgrenzt werden könnte. Und trotz des „stillschweigenden Einvernehmens“ auf den Verzicht der Anwendung der Nuklearwaffen besteht eben wegen des Machtungleichgewichts zu Lasten Russlands die akute Gefahr eines militärischen – wenn nicht gar nuklearen – Aufpralls der beiden bis an die Zähne bewaffneten nuklearen Leviathans.
In einer russischen Talkshow haben neulich mehrere Militärexperten bestritten, dass es infolge eines massiven nuklearen Schlagabtauschs zu einem zurzeit der „Kalten Krieges“ so befürchteten „nuklearen Winter“ kommen würde. Die Diskutanten begründeten ihre Überzeugung damit, dass die Atommächte Russland und die USA ihr Nuklearpotential wegen der Abrüstung derart dezimiert haben, dass es im Falle eines Atomkrieges zu einem „nuklearen Winter“ gar nicht kommen kann. Die Gefahr eines Atomkrieges – schlussfolgerten die Diskutanten – hat sich dadurch jedoch drastisch erhöht. Diese Diskussion sollte uns zumindest nachdenklich machen.
2. Geopolitik über alles?
1997 spekulierte Werner Link über ein sicherheitspolitisches Äquilibrium in der Hoffnung auf ein neues Balancesystem zwischen Russland und dem Westen nach dem Ende des „Kalten Krieges“. „Russland“ – meinte Link – „will die Osterweiterung (zumindest die der NATO) verhindern und verfolgt seinerseits … die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Re-Integration seines Vorfeldes … Ob Integration und Re-Integration gelingen werden, ist hier wie dort … eine offene Frage. Wenn sie gelängen, so würde sich ein neues Balancesystem zwischen EU und NATO einerseits und Russland und der von ihm geführten GUS andererseits herausbilden, in dem die Machtrelation für den Westen … äußerst günstig ausfiele.“5
Ein Vierteljahrhundert später können wir konstatieren: Keine(s) der russischen Vorhaben und Initiativen der 1990er-Jahre ist in Erfüllung gegangen. Die Reintegration des postsowjetischen Raumes hat sich als Flop erwiesen. Die NATO-Osterweiterung hat Russland nicht verhindern können. Es entstand nicht etwa „ein neues Balancesystem“ zwischen Russland und dem Westen, sondern ganz im Gegenteil eine die gesamteuropäische Sicherheit gefährdende Dysbalance – ein Machtungleichgewicht, das die Sicherheitsordnung in Europa bis heute prägt. Die „Machtrelation“ hat sich eindeutig zu Gunsten des Westens verschoben und die US-amerikanische Übermacht (praepondero) als sicherheitspolitisches Ordnungsprinzip in Europa etabliert.
Genau vor einer solchen Entwicklung warnte Werner Link eindringlich: „Dass Russland darin die Gefahr einer Hegemonie sieht, ist verständlich. Wenn die amerikanischen Befürchtungen, die von Huntington und anderen angesichts einer potentiellen europäischen Macht als real angesehen werden, muss dies erst recht für die russischen Befürchtungen gegenüber einer europäisch-amerikanischen Macht gelten … Anders als die europäisch-amerikanischen Beziehungen sind die Beziehungen des politischen Europas und der USA zu Russland eben nicht nur durch ökonomischen Wettbewerb (>geo-economics<), sondern auch durch machtpolitischen Wettbewerb (>geo-politics<) charakterisiert … Im Falle einer neuen akuten hegemonialen Bedrohung wäre die Entwicklung eines antagonistischen Gleichgewichtssystems wahrscheinlich.“6
Das Russland der 1990er-Jahre war viel zu schwach, orientierungslos, politisch und ökonomisch desorganisiert, um der geo- und sicherheitspolitischen Weichenstellung der US-amerikanischen Ordnungsmacht als „eines präponderierenden Staates“ (Friedrich Gentz) irgendetwas entgegensetzen und ein „antagonistisches Gleichgewichtssystem“, sprich: ein Machtungleichgewicht, verhindern zu können. Aus dem Machtungleichgewicht in Europa ist die US-Hegemonialordnung hervorgegangen und ihre Übermacht im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte immer mehr militärisch, geoökonomisch und geopolitisch ausgebaut worden, die bis heute (noch) Bestand hat.
Die in den letzten dreiundzwanzig Jahren geführten zahlreichen Interventionen und Invasionen haben allerdings die Hegemonialstellung dieses mächtigsten militärischen Kolosses aller Zeiten unterspült und erodieren lassen. Und jetzt? Der Krieg in der Ukraine ist für den US-Hegemon wie Manna vom Himmel gefallen. Jetzt versucht er seinen Erosionsprozess im Schatten des Krieges seines militärisch schärfsten geopolitischen Rivalen zu stoppen und sich zu konsolidieren.
Indem die USA den Ukrainekrieg mit massiven Waffenlieferungen und Ausbildung des ukrainischen Militärs in die Länge zu ziehen versuchen, um Russland militärisch und ökonomisch zu schwächen, handeln sie zu allererst im eigenen geostrategischen Interesse. Gleichzeitig bewirken sie aber das Gegenteil dessen, was sie mit ihrer zur Schau gestellten Unterstützung für die Ukraine öffentlich bekunden: Sie schwächen nicht so sehr Russland, als vielmehr die Ukraine selbst. Denn die Waffenlieferungen an die Ukraine führen nur noch zur Intensivierung der russischen Kriegsmaschinerie, die ihrerseits zu noch mehr Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur, zu noch mehr Verelendung der ukrainischen Bevölkerung und zu noch mehr Vernichtung der ukrainischen Lebensgrundlagen führt.
Das Schicksal der leidgeprüften ukrainischen Bevölkerung ist den US-Geostrategen offenbar ziemlich gleichgültig, solange ihren geostrategischen Zielen: Russland militärisch zu schwächen, geoökonomisch zu marginalisieren und moralisch zu delegitimieren, Genüge getan wird. Das hat eine sehr lange Tradition in der US-amerikanischen Geopolitik.
1998 enthüllte einer der einflussreichsten US-Geostrategen Zbigniew Brzezinski (1928-2017) in einem Interview mit der französischen Zeitung „Le Nouvel Observateur“, dass die USA bereits vor dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan die Mudschaheddin finanziell unterstützt hätten. Ziel sei es gewesen, die Wahrscheinlichkeit eines Einmarsches der Sowjets zu erhöhen. Gefragt, ob er die Unterstützung des islamischen Fundamentalismus inzwischen bereuen würde, antwortete Brzezinski unverblümt: „Was soll ich bereuen? Diese verdeckte Operation war eine hervorragende Idee. Sie bewirkte, dass die Russen in die afghanische Falle tappten und Sie erwarten ernsthaft, dass ich das bereue. Am Tag, da die Russen offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich Präsident Carter: Jetzt haben wir die Möglichkeit, der UdSSR ihr Vietnam zu liefern.“
Als der Interviewer nachhakt und auf die Verknüpfung von islamischem Fundamentalismus und Terrorismus hinweist, antwortet Brzezinski: „Was ist wohl bedeutender für den Lauf der Weltgeschichte? … Ein paar verwirrte Muslime oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?“7 Was ist in der Tat wohl bedeutender für den Lauf der Weltgeschichte: die Ausschaltung eines mächtigen geopolitischen Rivalen oder ein paar verwirrte und missbrauchte Muslime zwecks Aufrechterhaltung und Ausbau der US-Welthegemonie? So unsentimental kann nun mal die US-Geopolitik sein!
Und genau das passiert gerade im Falle der Ukraine, auch wenn die US-Amerikaner sie bei jeder Gelegenheit lautstark unterstützen und „uneigennützig“ und „uneingeschränkt“ für die Freiheit und Unabhängigkeit des Landes eintreten. Wissen die Ukrainerinnen überhaupt, mit welchen „Freunden“ sie zu tun haben? Es geht den US-Freunden allein um die Geopolitik. Alles andere sind nur Nebenschauplätze. Dass dabei die leidgeprüften Ukrainerinnen in Mitleidenschaft gezogen werden, ist lediglich eine Fußnote im Buch der Geschichte. Entscheidend sei, dass der geopolitische Rivale militärisch geschwächt, moralisch delegitimiert und ökonomisch ruiniert werde.
Wie weit kann nun eine solche Konfrontation gehen, ohne dass sie zum Casus belli zu werden droht und zu einem militärischen Zusammenprall der geopolitischen Rivalen führt? Die USA haben sich schon oft verschätzt – auch zu einer Zeit, als sie das Atomwaffenmonopol innehatten, indem sie die abschreckende Wirkung ihres Kriegspotentials auf die sowjetische Führung überschätzten. „Man war der Meinung gewesen“ – schrieb Raymond Aron 1953 -, „dass die Sowjets nicht nur keinen allgemeinen Krieg provozieren, sondern auch alles unterlassen würden, was die bestehende Spannung weiter verschärfen könnte. Darin hat man sich getäuscht. Die Sowjets haben sich nicht gescheut, die Vereinigten Staaten herauszufordern.“8
Nichts anderes geschieht auch heute. Heute geht es aus russischer Sicht um ein geopolitisches Überleben des Landes! Den Krieg in der Ukraine zu verlieren (in welchem Sinne auch immer), sei für die russische Führung keine Option. Der Krieg werde entweder erfolgreich zu Ende geführt oder Russlands geopolitisches Überleben stehe zur Disposition. Es geht für die russische Seite auch, aber eben nicht nur und nicht in erster Linie um die Ukraine, sondern um die Wiederherstellung eines Machtgleichgewichts und die Zurückdrängung der US-Expansionspolitik in Europa. Eine Art „Roll Back“-Politik à la russisch!? Das setzt aber gleichzeitig „die Zurückweisung des Jahres 1991“ (Sergej Karaganov) voraus, worauf das Machtungleichgewicht als Ordnungsprinzip der europäischen Sicherheit nach dem Ende des Ost-West-Konflikts zurückzufuhren ist.
Das Ende der Sowjetunion war der Anfang der US-Expansionspolitik über Westeuropa hinaus. Sie stand in der Kontinuität der US-amerikanischen Europapolitik nach 1945, welche im ureigenen Interesse „Hegemonie durch Integration“9 anstrebte. Als „Hegemonialmacht der westlichen Welt seit 1945“ schickten sich die USA nach 1991 nunmehr an, ihre Hegemonialpolitik auch über ganz Europa auszuweiten. Das probate Mittel dazu war die NATO-Osterweiterung. Mit ihrer militärischen, ökonomischen und technologischen Übermacht hatten sie auch alle Voraussetzungen dazu, um ihren Hegemonialwillen durchzusetzen.
Dem stand in den 1990er-Jahren nichts im Wege. Mehr noch: Russland war ja selbst bereit und willig, sich in die NATO-Sicherheitsstrukturen integrieren zu lassen, was aus US-amerikanischer Sicht völlig ausgeschlossen war. Denn dann wäre die US-Hegemonialstellung in Europa verwässert und die „Hegemonie durch Integration“ unterspült.
Und so kam es, wie es kommen musste: Wie zuvor die Sowjetunion, die sich nach 1945 weigerte, sich in das amerikanisch dominierte Weltsystem („One World“) nicht zuletzt aus ideologischen Gründen zu integrieren, so erwies sich letztendlich der Versuch, Russland in die westlichen Macht- und Sicherheitsstrukturen zu integrieren, als eine Illusion. Die russischen Macht- und Funktionseliten der 1990er-Jahre waren zwar westlich gesinnt und zu dieser Zeit durchaus bereit und willig, sich in die sog. „westliche Wertegemeinschaft“ integrieren zu lassen. Dazu kam aber dennoch nicht.
Warum? Wegen der geopolitischen und kulturellen Inkongruenz der beiden Protagonisten. Die NATO-Osterweiterung hat diese Sachlage lediglich verschlimmbessert, aber nicht verursacht. Russlands Integration in die „westliche Wertegemeinschaft“ könnte „nur“ unter einer einzigen Bedingung gelingen: eine allumfassende Akzeptanz der US-Hegemonialrolle durch Russland. Käme es dazu, beginge Russland einen geopolitischen Selbstmord. Das heißt: Russland hätte aufgehört, als eine geopolitische Raumeinheit zu existieren und wäre zerfallen.
Die Folge wäre dann nicht die US-Hegemonie über Russland durch Integration von ganz Europa, sondern Russlands Zerfall infolge der Herrschaft des kollektiven Westens über ganz Europa und Eurasien. Der Krieg in der Ukraine ist der Versuch Russlands, das seit dem Untergang des Sowjetimperiums bestehende Machtungleichgewicht auf dem europäischen Kontinent zu sprengen, sicherheitspolitisch zu Gunsten Russlands zu revidieren und sich vom geopolitischen Zwangskorsett der USA zu befreien.
3. Was wäre, wenn …?
Welche westliche Russlandpolitik wäre trotz alledem nach der Beendigung des „Kalten Krieges“ richtig, damit Russland und der Westen sich sicherheitspolitisch einigen könnten und Russland sich in die „westliche Wertegemeinschaft“ erfolgreich integrieren könnte?
Der Westen hat sich nach dem ideologischen Sieg über den Sowjetkommunismus für eine axiologische Offensive im postsowjetischen Raum entschieden, ohne Rücksicht auf Russlands völlig andere historische, kulturelle und geopolitische Tradition. Dieser axiologische Geltungsanspruch des Westens führte seine Russlandpolitik letztlich in eine ideologische und geopolitische Sackgasse, obwohl die geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen für den Westen anfänglich sehr günstig erschienen:
1. Das Sowjetimperium ist – wie noch nie in der russischen Geschichte – in einzelne staatsähnliche Machtgebilde zerfallen.
2. Das Russland der 1990er-Jahre lag am Boden: politisch, ökonomisch, ideologisch und hat im globalen Raum keine Rolle mehr gespielt.
3. China war ökonomisch noch zu schwach und es sah alles danach aus, als ob die sog. „liberale Demokratie“ verfassungspolitisch, marktwirtschaftlich und axiologisch weltweit triumphierend auf dem Vormarsch ist. Jedes wie auch immer geartete Zugeständnis an Russland erschien darum für den Westen in jener Zeit derart absurd, dass selbst ein Gedanke darüber nicht der Rede wert war.
Den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen war jedoch kein Erfolg beschieden und ihre Verschlechterung war zwar eine allmähliche und schleichende, aber eben keine überraschende Entwicklung. Man dachte, lebte und handelte aneinander vorbei: Angefangen bereits mit Gajdars Reformen, die der russischen Bevölkerung viel Leid und Entbehrung abverlangten und letztlich zur gescheiterten Transformation führten, deren vorläufiger Höhepunkt im Finanzdesaster 1998 mündete, setzte sich der Entfremdungsprozess zwischen Russland und dem Westen mit dem Kosovo-Krieg (1999) fort, der in der russischen Öffentlichkeit – vom Westen völlig ignoriert – Entsetzen und Empörung auslöste.
Der Aufstieg Putins mit seiner allmählichen Abwendung vom Westen, die westliche Kritik an zwei Tschetschenienkriegen, Putins Münchener Rede (2007) usw. usf. waren deutliche Alarmzeichen, bis schließlich der Ausbruch der sog. „Ukraine-Krise“ (2014) und der momentan tobende Krieg in der Ukraine das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen endgültig zerrüttet und vergiftet hat.
Wäre eine andere Entwicklung als die in den 1990er-Jahren und danach stattgefundene überhaupt denkbar und möglich? Die westlich gesinnten und an die Macht gelangten Machteliten im Russland der 1990er-Jahre waren von „der“ westlichen Lebenskultur genauso wie von der missverstandenen Marktwirtschaft („рыночная экономика“)10 derart besessen, dass jeder Alternativgedanke zu einem imaginären Westen als abstrus erschien.
Auch für die vorherrschende westliche „liberale Theorie“ kam alles andere als die Verwirklichung der „westlichen Werte“ gar nicht in Frage. Für sie war nicht „das Machtgleichgewicht Garant für Ordnung, sondern die Durchsetzung von Wertordnungen, die sich in liberalen Demokratien und in den Menschenrechten manifestieren.“11 Und genau hier lag das grundsätzliche ideologische und geopolitische Problem der westlichen und insbesondere US-amerikanischen Sicherheitspolitik. Die geo- und sicherheitspolitische Idee vom Machtgleichgewicht wurde durch die außenideologische Kernvision12 substituiert.
Diese Kernvision vor allem der US-Demokraten, deren Ursprung auf Woodrow Wilsons Bemühen, die Welt „safe for democraty“ zu machen, genauso wie auf Roosevelts „Messias-Komplex“ oder Trumans Zukunftsvision von einer „das amerikanische System“ übernehmenden Welt zurückgeführt werden kann, geht von der irrigen Grundannahme aus, dass die Verfassungsform eines Staatswesens auch ihr Außenverhalten vorausbestimmt.13 „Die historischen Erfahrungen“ – stellte Herbert Dittgen bereits 1996 zutreffend fest – „sprechen eindeutig gegen eine solche Behauptung.“14
Die vergangenen dreißig Jahre haben diese Grundannahme nicht nur gründlich widerlegt, sondern geradezu in ihr Gegenteil verkehrt: Die „liberalen Demokratien“ erkauften ihren liberalen Frieden in der Innenwelt mit dem Unfrieden in der Außenwelt, ja der Unfriede wurde oft bewusst in Kauf genommen oder gar gezielt herbeigeführt. Die eigene Sicherheit und der eigene Wohlstand gingen vor und im Zweifel zu Lasten der Außenwelt!
Vor diesem Hintergrund ist man eher geneigt, einem anderen US-Demokraten – dem Außenminister James F. Byrnes (1945–1947) – zuzustimmen, der 1949 nüchtern feststellte: „Was wir tun müssen, ist nicht die Welt für die Demokratie, sondern für die Vereinigten Staaten sicherer zu machen.“ Dieser sicherheitspolitische Ansatz wurde in den 1990er-Jahren seiner geopolitischen Substanz entkleidet und vor dem Hintergrund des präponderierenden US-Hegemonen ideologisiert. Es ging nämlich infolge der fehlenden Gegenmacht nicht mehr um eine Machtgleichgewichtspolitik („Gleichgewicht des Schreckens“) der Supermächte wie zurzeit der bipolaren Weltordnung, sondern um die ideologisch fundierte Durchsetzung der nunmehr auf dem Machtungleichgewicht beruhenden unipolaren Welt des US-Hegemonen.
Diese Vermengung von Sicherheitspolitik und Ideologie, Geopolitik und Axiologie veranlasste Lothar Brock bereits 2007 verwundert zu fragen: „Warum wird das Konfliktgeschehen der Gegenwart in ganz erheblichem Maße durch die Gewaltanwendung der demokratischen Staaten bestimmt? Warum sind in den liberalen Demokratien neue Sicherheitsdiskurse in Gang gekommen, die in Verbindung mit einer Ausweitung des Konzepts der Verteidigung (Art. 54 UN-Charta) und einer verengten Interpretation des Gewaltverbots (Art. 2, Abs. 4) einer erneuten >Enttabuisierung des Militärischen< … nach dem Ende des Ost-West-Konflikts Vorschub leisten?“15
Woher kommt nun in der Tat diese nach dem Ende des Kalten Krieges „urplötzlich“ stattgefundene „Enttabuisierung des Militärischen“? Liegt dies vielleicht daran, dass der dem Westen im Wege stehende ideologische und geopolitische Rivale schlicht untergegangen ist und der US-Hegemon in seiner präponderierenden „Machtvollkommenheit“ weder Hemmungen noch Skrupel mehr verspürte, auf irgendjemand Rücksicht zu nehmen, um den eignen Hegemonialwillen durchsetzen zu können? Das wäre doch die naheliegende Antwort!
Brock beantwortet hingegen die Frage ganz anders. Die infolge der veränderten geopolitischen Kräfteverhältnisse nach dem Ende des Kalten Krieges stattgefundene „Enttabuisierung des Militärischen“ führt er auf die „Evolution des Völkerrechts“, nämlich auf eine Evolution „von einem Recht zur Regelung des Krieges zu einem Recht der kollektiven Friedenssicherung“16 zurück. Das ist aber nichts anderes als eine verklausulierte Rechtsbegründung des Westens, sich selbst zu ermächtigen, die „kollektive Friedenssicherung“ im Namen des „evolutionären Völkerrechts“ notfalls militärisch zu erzwingen, da mit „Kollektiv“ hier de facto (nicht de jure) nur der kollektive Westen gemeint sein kann.
Die auf einer Vermengung von Geopolitik und Axiologie beruhende „Weiterentwicklung des Konzepts der Menschenrechte“ diente letztlich ebenso wenig zu einer „Stärkung des internationalen Schutzes der klassischen politischen Rechte“17 wie zu mehr Sicherheit auf dem europäischen Kontinent. Vielmehr zeigte eine solche „Weiterentwicklung“, dass die Transformation der Nachkriegsordnung in eine vom US-Hegemonen dominierte, als „liberal“ verklärte und vom Machtungleichgewicht als Ordnungsprinzip geleitete US-Sicherheitspolitik in Europa mit ihrer NATO-Osterweiterung mehr Unsicherheit produzierte und letztendlich zur militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO auf ukrainischem Boden führte.
Nun steht eben dieses sicherheitspolitische Ordnungsprinzip infolge des Ukrainekrieges zur Disposition und es stellt sich die naheliegende Frage: Was wäre, wenn statt Vermengung eine Entkopplung von Sicherheitspolitik und Ideologie, Geopolitik und Axiologie stattgefunden hätte? Hätte die gesamteuropäische Sicherheitsordnung dann anderes aussehen können? Die Frage werden wir wohl nicht mehr beantworten können.
4. Wie geht es weiter?
Die aktuelle bis aufs Äußerste angespannte Sicherheitslage in Europa wird zunehmend instabiler, fragiler und feindseliger. Sie schreit geradezu nach sicherheitspolitischen Veränderungen. Es passiert aber nichts, sieht man von gegenseitigen Drohgebärden aller Art ab. Angesichts dieser Instabilität und Fragilität ist ein neues Sicherheitskonzept in Europa längst überfällig geworden. Das Machtungleichgewicht hat vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges als Ordnungsprinzip an Bedeutung verloren und ist fragwürdig geworden.
Die zugespitzte Konfrontation zwischen Russland und dem Westen macht es erforderlich, über neue sicherheitspolitische Wege nachzudenken. Eine Deeskalationspolitik ist heute gefragter denn je und erneut stellt sich die Frage nach einer neuen europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung. Die USA können ebenso wenig wie die EU ihren Machtwillen Russland aufzwingen trotz zahlreichen Sanktionen. Ob sie das wollen oder nicht, müssen die beiden geopolitischen Kontrahenten sich auf einen sicherheitspolitischen Modus Vivendi einigen (können).
Denn eine weitere Chaotisierung des europäischen Kontinents birgt in sich die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation, die zur friedensgefährdenden Situation für ganz Europa führen kann. Das liegt zumindest nicht im Eigeninteresse der Kontinentaleuropäer, auch wenn die Angelsachsen womöglich einer ganz anderen Meinung sind und damit gut leben können.
Dabei hängt alles von der Frage nach der Natur einer künftigen Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa ab und mit welchen Mitteln und Ressourcen man diese Neugestaltung beizukommen bereit und in der Lage wäre. Heute wird die westliche Sicherheitspolitik maßgeblich axiologisch bestimmt und lässt sich vom universalen, auf dem „westlichen Wertekanon“ beruhenden Charakter der Friedensordnung leiten. Das war nicht immer so.
Die 1970er-Jahre markierten mit Nixons Entspannungspolitik eine Abwendung von der ideologisch geleiteten US-Außenpolitik. „Kissinger nannte es die Rückkehr zur Realpolitik . . ., ohne dass sie die endgültige Abkehr von den Wilsonschen Ideale bedeutete. Tatsächlich hatte die Administration mit dem neuen Kurs jenen Mittelweg zwischen Konfrontation und Status quo-Denken beschritten.“18
Der von der Nixon-Administration eingeleitete Kurswechsel in der US-amerikanischen Außenpolitik markierte „den Beginn einer neuen Ära“, deren „hervorstechendes Merkmal“ war: 1. „größere Zurückhaltung in der Weltpolitik“, 2. die Politik des „praktisch Möglichen“ statt ideologisch motivierter Weltpolitik und schließlich 3. „klare Rangordnung der Prioritäten statt Weltordnungspolitik.“19 Die Außen- und Sicherheitspolitik der Nixon-Administration bedeutete letztlich „die radikale Abkehr von den konventionellen Strategieansätzen der Containment-Politik und einer über zwei Jahrzehnte lang primär ideologisch motivierten Weltpolitik bei gleichzeitiger Relativierung des Suprematiegedankens.“20
In der Nixon-Administration setzte sich die Erkenntnis durch, „dass Sicherheit auf einem vernünftigen globalen Kräftegleichgewicht beruhte, Weltpolitik also von Disharmonien geprägt war und von der Bereitschaft abhing, Kompromisse auszuhandeln.“21 Nixon/Kissingers Außenpolitik folgte de facto „einer an den Prinzipien der Realpolitik orientierten, globalen Gleichgewichtspolitik, die nicht auf ideologische Konfrontation setzt, sondern einen Interessenausgleich anstrebt. >Ideologische Rigidität und politischer Pragmatismus<, bei kaum einem Präsidenten zuvor fanden sich beide Grunddeterminanten amerikanischer Außenpolitik der Nachkriegszeit in so einzigartiger Weise kombiniert. Wären Watergate und der Selbstzerstörungsprozess des Präsidenten nicht gewesen, die Nixon-Revolution hätte womöglich die USA und die Welt noch tiefgreifender und nachhaltiger verändert.“22
Die Zentrierung der Entspannungspolitik um Stabilitäts- bzw. Friedenspolitik hat Kissinger allerdings die Kritik seiner Kontrahenten angebracht: Er schere sich nicht um die Menschenrechtspolitik. Kissinger sah seinerseits diese Kritik seiner Opponenten als unangebracht. „Er teilte nicht die Ansicht jener Kritiker seiner Politik, die in internen Veränderungen der Sowjetunion eine Vorbedingung jeglicher Entspannungspolitik sahen.“ Ausschlaggebend war für ihn allein das außenpolitische Handeln der Sowjets, wobei die Entspannungspolitik seiner Meinung nach auch „die besten Voraussetzungen für innenpolitische Veränderungen“ geschaffen habe.
„Genau an diesem Punkt aber hakten seine Kritiker ein. Aus ihrer Sicht hatte die Unterdrückung der sowjetischen Dissidenten mit Einsetzen der Entspannungspolitik begonnen.“ Auch die Appelle der Dissidenten, das Sowjetregime zu innenpolitischen Zugeständnissen zu zwingen, sahen die Gegner der Entspannungspolitik als Bestätigung ihrer Kritik an. Kissinger reagierte auf die Kritik mit dem Argument, dass „die Erhaltung des Friedens oberstes Gebot sei“ und man „den Frieden – oder die Entspannungspolitik (eine Gleichsetzung, die von den Kritikern nicht unbedingt akzeptiert wurde) – nicht wegen untergeordneter moralischer Prinzipien gefährden (dürfte).“23
Die Entspannungspolitik war – wie man sieht – eine direkte Folge der Priorisierung der Stabilitätspolitik als Friedenspolitik vor allen anderen ideologischen und moralischen Erwägungen, auch wenn die Sowjetführung selbst im Verlauf der insbesondere ein Handelsabkommen betreffenden Verhandlungen letztendlich Zugeständnisse in der Innenpolitik machte. Diese sich allein an der Stabilitätspolitik orientierte, aus der Not geborene Entspannungspolitik der Nixon-Administration war – langfristig gesehen – nicht tragfähig und jederzeit gefährdet, da sie vor dem Hintergrund eines scharfen ordnungspolitischen, axiologischen und ideologischen Antagonismus der Supermächte unter nuklearstrategischen Bedingungen der beiderseitigen gesicherten Vernichtungsfähigkeit stattfand.
In dieser Entspannungspolitik war bereits ein die Stabilität und die Kooperationsbereitschaft ignorierender ideologischer Sprengstoff gelegt, den die Reagan-Administration in den 1980er-Jahren zur Explosion brachte, die ihrerseits die ganze Entspannungspolitik letztlich unter sich begrub. Die „Nixon-Doktrin“ erweist sich zwar für die Gegenwart eher als Fata Morgana denn als Blaupause. Die ihr zugrundeliegenden realpolitischen Intentionen bleiben aber dessen ungeachtet aktueller denn je.
Anmerkungen
1. Gentz, F. von, Fragmente aus der neuesten Geschichte des Politischen Gleichgewichts in Europa, 2. Aufl. St. Petersburg 1806, 8; zitiert nach Werner Link, Die europäische Neuordnung und das Machtgleichgewicht, in: Jäger, Th. u. a. (Hrsg.), Europa 2020. Szenarien politischer Entwicklungen. Opladen 1997, 9-31 (11).
2. Aron, R., Der permanente Krieg. Frankfurt 1953, 257.
3. Aron (wie Anm. 2), 222.
4. Zum Begriff siehe Silnizki, M., Geo-Bellizismus. Über den geoökonomischen Bellizismus der USA. 25. Oktober 2021, www.ontopraxiologie.de.
5. Link (wie Anm. 1), 29.
6. Link (wie Anm. 1), 29, 31.
7. Zitiert nach Ritz, H., Warum der Westen Russland braucht. Die erstaunliche Wandlung des Zbiegniew Brzezinski, in: Blätter f. dt. u. intern. Politik 57 (2012), 89-97 (90).
8. Aron (wie Anm. 2), 257.
9. Conze, E., Hegemonie durch Integration? Die amerikanische Europapolitik und ihre Herausforderung durch de Gaulle, in: Vierteljahrshefte f. Zeitgeschichte 43 (1995), 297-340.
10. Näheres dazu Silnizki, M., Geoökonomie der Transformation in Russland. Gajdar und die Folgen. Berlin 2020.
11. Dittgen, H., Das Dilemma der amerikanischen Außenpolitik: Auf der Suche nach einer neuen Strategie, in: Dittgen, H./Minkenberg, M. (Hrsg.), Das amerikanische Dilemma. Die Vereinigten Staaten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Paderborn 1996, 291-317 (296 f.).
12. Dazu Silnizki, M., Außenpolitik ohne Außenpolitiker. Zum Problem der Außenideologie in der Außenpolitik. 6. Dezember 2021, www.ontopraxiologie.de.
13. Siehe dazu Silnizki, M., Anti-Moderne. US-Welthegemonie auf Abwegen. Berlin 2021, 78 f.
14. Dittgen (wie Anm. 11).
15. Brock, L., Universalismus, politische Heterogenität und ungleiche Entwicklung: Internationale Kontexte der Gewaltanwendung von Demokratien gegenüber Nichtdemokratien, in: Geis u. a. (Hrsg.), Schattenseiten des Demokratischen Friedens. Frankfurt/New York 2007, 45-68 (46).
16. Brock (wie Anm. 15), 51.
17. Brock (wie Anm. 15), 54.
18. Näheres dazu Fröhlich, S., Zwischen selektiver Verteidigung und globaler Eindämmung. Geostrategisches Denken in der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik während des Kalten Krieges. Baden-Baden 1998, 387.
19. Fröhlich (wie Anm. 18), 388.
20. Fröhlich (wie Anm. 18), 391.
21. Fröhlich (wie Anm. 18), 396.
22. Fröhlich (wie Anm. 18), 391f.
23. Schweigler, G., Von Kissinger zu Carter. Entspannung im Widerstreit von Innen- und Außenpolitik 1969-1981. München Wien 1982, 196 f.