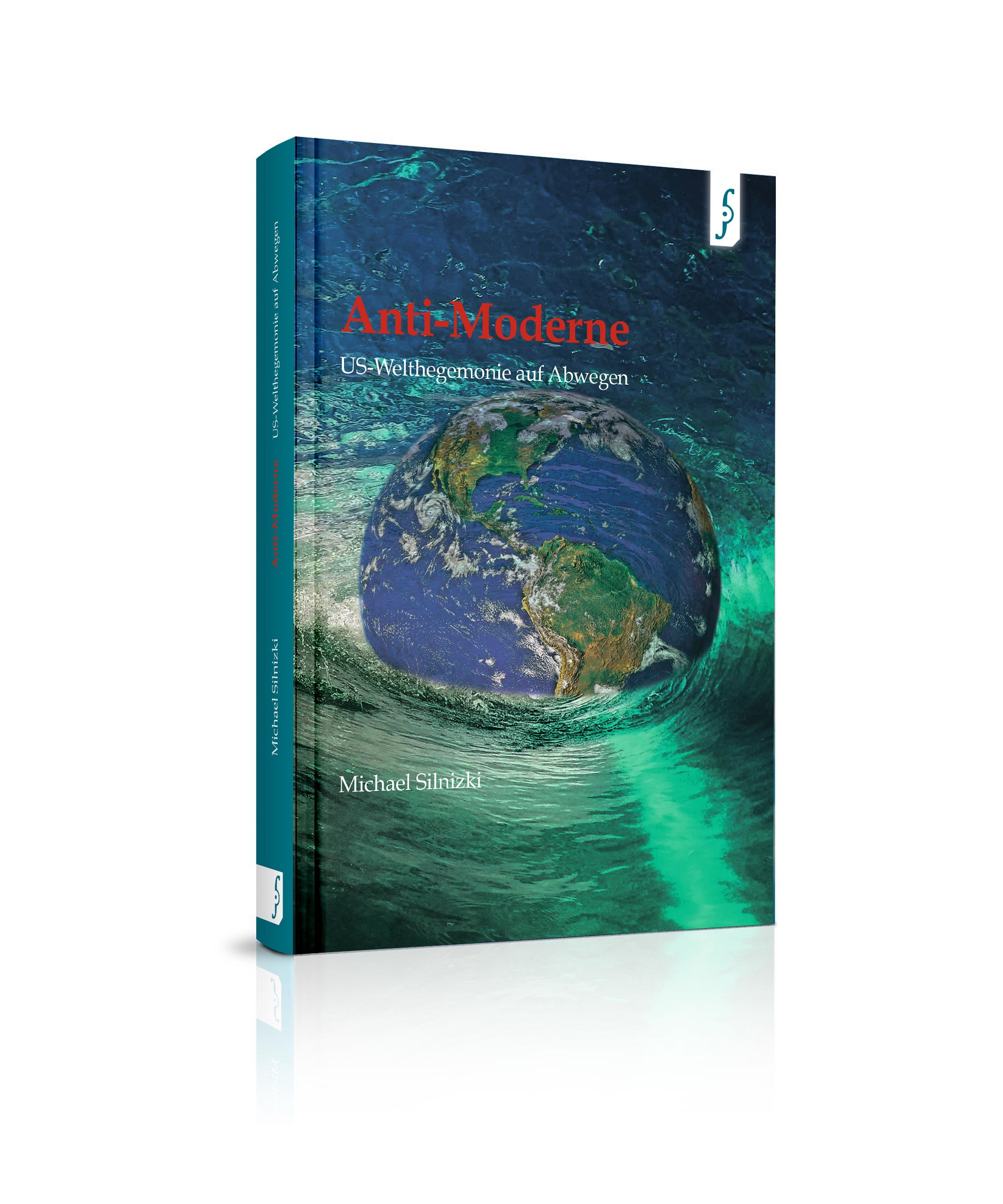Zur Frage nach den „Pathologies of Primacy“ in der US-Außenpolitik
Übersicht
1. „Die Vision der amerikanischen Hegemonie“
2. Der „nächste Irak“, „Großmachtkrieg“ und die europäische Sicherheit
3. Geoökonomisches Abschöpfungsmodell und seine Gefährdung
Anmerkungen
Sic transit gloria mundi
(So vergeht der Ruhm der Welt)
1. „Die Vision der amerikanischen Hegemonie“
Zwanzig Jahre nach der Irak-Invasion zieht die außenpolitische US-Publizistik immer mehr eine kritische Bilanz über die US-Außenpolitik seit dem Ende des Ost-West-Konflikts.
Nachdem Max Boot in seinem Aufsatz „What the Neocons Got Wrong“ (Foreign Affairs, 10. März 2023) eine heftige Kritik gegen den „Demokratieexport“ der US-Außenpolitik geübt hat und als Ex-Neocon auf Distanz zu der gescheiterten US-amerikanischen Demokratisierungsstrategie gegangen ist1, veröffentlichte Stephen Wertheim eine Woche später in der gleichen Zeitschrift eine umfangreiche und anspruchsvolle Studie „Iraq and the Pathologies of Primacy. The Flawed Logic That Produced the War Is Alive and Well“ (Foreign Affairs, 17. März 2023).
In seinen Ausführungen übt Wertheim ebenfalls scharfe Kritik gegen die US-Außenpolitik der vergangenen drei Jahrzehnte und rechnet mit ihr vor dem Hintergrund der vor genau zwanzig Jahren am 20. März 2003 begonnenen US-Irak-Invasion ab. Sein Haupteinwand lautet: Der US-Außenpolitik liege nach wie vor ein verfehltes, aber immer noch unverändert bestehendes „Streben nach einer globalen Vormachtstellung“ und „globalen Dominanz“ („the pursuit of global primacy“ und „global dominance“) zugrunde.
Diese Grundthese der Studie wird im Nachfolgenden näher untersucht. Sie stimmt insofern, als sie darauf hindeutet, dass die US-Außenpolitik immer noch Brzezinskis „imperialer Geostrategie“2 folgt.
Zwar habe Washington laut Wertheim einige Lehren aus dem Irak-Krieg gezogen und die US-Politiker sowie Experten lehnen mittlerweile die „Regime change“-Politik ab. Auch bei der Gewaltanwendung haben sie „die Tugend der Klugheit“ (the virtue of prudence) wiederentdeckt und begriffen, dass Demokratie kaum mit vorgehaltener Waffe durchzusetzen sei. Diese Lektionen seien gut und richtig, sie reichen aber bei weitem nicht aus. Denn sie betrachten den Irak-Krieg lediglich als „einen politischen Fehler“ (a policy error), der korrigiert werden konnte, und lassen folgerichtig die hegemoniale Ausrichtung der US-Außenpolitik unverändert bestehen.
Dass das US-Establishment heute die „Regime change“-Politik ablehne und folglich Demokratie nicht mehr mit vorgehaltener Waffe durchsetzen wolle, kann man getrost dem Bereich der Mythenbildung zuordnen, liegt es doch in der Natur einer jeden Hegemonie die unliebsamen „Regime“ jederzeit – wenn nicht stürzen, so zumindest – verändern zu wollen.
Die Irak-Invasion war in der Tat mehr als nur ein „politischer Fehler“. Und so hält Wertheim dem US-Establishment vor: Es habe den seit dem Ende des „Kalten Krieges“ einmal eingeschlagenen Weg in der Außenpolitik bis heute beibehalten und nie verlassen. Die US-Außenpolitik bestehe nach wie vor im Streben „nach einer hegemonialen Weltrolle“ (the hegemonic world role), „globalen Dominanz“ (global dominance) bzw. „globalen Vormachtstellung“ (global primacy) und schlage gegen jeden hart zu, der die US-Hegemonie in Frage zu stellen wage.
Folgt man diesen Vorhaltungen von Stephen Wertheim , so stellt man in der Tat fest, dass die US-Außenpolitik immer noch nicht verstanden hat, was Robespierre schon vor gut zweihundert Jahren erkannte: „Niemand liebt bewaffnete Missionare.“
Weil das so ist, wie es ist, betrachten die USA laut Wertheim „die globale Dominanz fast als Selbstzweck“ (global dominance almost as an end in itself) und lassen alle anderen „strategischen Alternativen“ (strategic alternatives) außer Acht. Ist aber die „global dominance“ wirklich ein „Selbstzweck“ oder vielleicht nur ein Mittel zum Zweck? Dieser Frage gehen wir später im dritten Teil der Analyse nach.
Auf jedem Falle sei die Irak-Invasion laut Wertheim aus einer hegemonialen Logik entstanden und habe nur „Chaos, Aufstand, und Zerstörung“ (chaos, insurgency, destruction) verursacht. Sie hätte eigentlich die Strategie der „globalen Dominanz“ diskreditieren müssen. „Stattdessen bleibt das Streben nach der Vormachtstellung (unverändert) bestehen“ (Instead, the quest for primacy endures), beklagt sich Wertheim .
Diese hegemonialen Ambitionen der USA stoßen zunehmend auf einen wachsenden Widerstand auf der ganzen Welt, konstatiert er. Dessen ungeachtet setze Washington nach wie vor „die US-Machtprojektion mit amerikanischen Interessen“ (U.S. power projection with American interests) gleich und versuche immer noch die geopolitischen Rivalen zu domestizieren. Das sei aber ein Ding der Unmöglichkeit – erst recht, wenn es um die Großmächte gehe, die mit Atomwaffen bewaffnet seien, (Against major powers armed with nuclear weapons, they may be much worse).
Zu Recht weist Wertheim darauf hin, dass die Entstehung, Entwicklung und Ausbildung der hegemonialen US-Außenpolitik gleich mit dem Ende des Ost-West-Konflikts begannen. Drei einflussreichen Repräsentanten der Bush-Administration – Dick Cheney, Colin Powell und Paul Wolfowitz – haben schon Anfang der 1990er-Jahre diese Entwicklung in Gang gesetzt.
Bereits 1992 formulierte Colin Powell (von 1989 bis 1993 Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff), das Ziel der US-Außenpolitik, „genügend Macht“ zu besitzen, um „jeden Herausforderer davon abzuhalten, jemals davon zu träumen, uns auf der Weltbühne herauszufordern“. „I want to be the bully on the block“, sagte er im Kongress.
Auch das von Paul D. Wolfowitz konzipierte, der „New York Times“ 1992 zugespielte und weltweit Aufsehen erregte Strategiepapier „Defense Planning Guidance“ setzte sich zum Ziel der US-Außenpolitik, „den Aufstieg neuer Rivalen überall zu verhindern – also das Emporkommen der Staaten, die Washington feindlich gesinnt seien“.
Zutreffend brachte Wertheim diese geostrategische Zielsetzung der US-Außenpolitik oder – wie er es nennt – die „vision of American hegemony“ auf einen Nenner: „das Machtgleichgewicht durch die amerikanische Übermacht zu substituieren“ (replace balances of power with an American preponderance of power).
Diese „Vision der amerikanischen Hegemonie“ ist in der Tat auf dem europäischen Kontinent in Erfüllung gegangen. Der ewige Kampf zwischen zwei widerstreitenden Grundprinzipien der europäischen Sicherheits- und Friedensordnung: Gleichgewicht oder Hegemonie wurde nach dem Untergang des Sowjetimperiums zu Gunsten der Hegemonie entschieden.
Das Russland der 1990er-Jahre war viel zu schwach, orientierungslos, politisch und ökonomisch desorganisiert und desorientiert, um einer geo- und sicherheitspolitischen Weichenstellung der US-amerikanischen Ordnungsmacht als „eines präponderierenden Staates“ (Friedrich Gentz ) irgendetwas entgegensetzen und ein Machtun gleichgewicht auf dem europäischen Kontinent verhindern zu können. Aus dem Machtun gleichgewicht in Europa ist die US-Hegemonialmacht hervorgegangen, die ihre Übermacht im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte immer mehr militärisch, geoökonomisch und geopolitisch ausgebaut und die bis heute (noch) Bestand hat.
Es entstand, anderes formuliert, ein hegemoniales Machtun gleichgewicht bzw. eine hegemoniale Dysbalance als Ordnungsprinzip der europäischen Sicherheits- und Friedensordnung.
Diese hegemoniale Dysbalance auf dem europäischen Kontinent ist allein dem Umstand geschuldet, dass die USA sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts als die gesamteuropäische Ordnungsmacht etablierten und zur Hegemonialmacht zu Lande und zur See in Europa aufgestiegen sind. Im Gegensatz zu den USA war beispielsweise das British Empire des 19. Jahrhunderts nicht an der Beherrschung des europäischen Kontinents zu Lande interessiert. „Großbritanniens Hegemonie war von jener Art, die sich mit dem Gleichgewicht des Kontinents vertrug, ja es voraussetzte,“3 wohingegen die US-Hegemonie von jener Art ist, die sich „mit dem Gleichgewicht des Kontinents“ nicht verträgt und eine hegemoniale Dysbalance auf dem europäischen Kontinent zur Voraussetzung hat.
Was die US-Geostrategen nun in Europa erfolgreich verwirklichen konnten, versuchten sie – bewusst oder unbewusst, sei dahingestellt – mit einer brachialen militärischen Gewalt auch über die ganze Welt auszubreiten und sind dabei nicht zuletzt im Irak-Krieg kläglich gescheitert. Die am 20. März 2003 begonnene Irak-Invasion war im Grunde der Anfang vom Ende der kurzlebigen unipolaren Weltordnung unter Führung des US-Hegemonen. Dies zu erkennen, ist ein Verdienst der von Stephen Wertheim verfassten Studie.
2. Der „nächste Irak“, „Großmachtkrieg“ und die europäische Sicherheit
Betrachtet man nun den globalen Raum der Gegenwart, so begegnet man einer ganz anderen geopolitischen Machtkonstellation, der weder Gleichgewicht noch Hegemonie noch hegemoniale Dysbalance, sondern eine posthegemoniale Dysbalance zugrunde liegt. Wir haben heute eine geo- und sicherheitspolitisch gespaltene Welt, in welcher die hegemoniale Dysbalance (in Europa) und die posthegemoniale Dysbalance (im Rest der Welt)4 die zwei systembildenden Strukturen der globalen Sicherheits- und Friedensordnung sind, in deren Zentrum drei rivalisierende, bis an die Zähne bewaffnete Groß- und Supermächte stehen: die USA, China und Russland.
In dem nun ausgebrochenen Zeitalter der Großmächterivalität ignoriert das US-Establishment eben diese gespaltene Welt und versucht immer noch die hegemoniale Dysbalance als europäisches Ordnungsprinzip, das mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine von Russland in Frage gestellt wurde, auf den globalen Raum zu übersetzen, in dem ein ganz anderes sicherheitspolitisches Ordnungsprinzip dominiert.
Und genau diese Verkennung einer neuentstandenen geopolitischen Großmächtekonstellation wirft Wertheim der US-Außenpolitik vor. Mit der Fokussierung der US-Außenpolitik allein auf „global primacy“ ignoriert Washington seiner Meinung nach zwei kardinale Probleme:
(1) Zum einen könnte das US-amerikanische Streben nach Hegemonie die Entstehung einer Gegenmacht heraufbeschwören, die sich der US-Hegemonie in den Weg stellt und nicht gewillt ist, sich dem US-amerikanischen „ewigen Frieden“ (perpetual peace) zu unterwerfen. Wie wir heute wissen, es ist viel schlimmer gekommen. Statt einer Gegenmacht haben die USA zwei Gegenmächte – Russland und China – bekommen, die nunmehr gemeinsam drauf und dran sind, die unipolare Weltordnung nicht nur in Frage zu stellen, sondern diese auch zu zerstören.
Die USA haben sich davon täuschen lassen, dass Russland in den 1990er-Jahren politisch, sozial und ökonomisch wehrlos am Boden lag und dass China ökonomisch noch zu schwach war, um der von den USA geführten unipolaren Weltordnung Parole bieten zu können. Freilich haben die Russlandkenner und die erfahrenen westlichen Politiker (wie etwa Helmut Schmidt ) immer schon eine Wiederauferstehung Russlands prophezeit.
(2) Zum zweiten führte die der US-Außenpolitik zugrundeliegende „imperiale Geostrategie“ (Brzezinski ) zur Machtüberdehnung des US-Hegemonen. Zu Recht stellt Wertheim fest, dass die USA Kriege riskierten, die von den US-Interessen losgelöst seien. „Cheneys Pentagon“ – schreibt Wertheim – „wollte einen Widerstand gegen die amerikanische Vormachtstellung sinnlos machen“. „Was wäre“ -fragt er spöttisch -, „würde stattdessen der Widerstand die amerikanische Vormachtstellung sinnlos machen?“ (Cheney’s Pentagon wanted American primacy to make resistance futile. What if resistance made American primacy futile instead?)
Und so schlüpften die USA immer mehr in die Rolle eines Weltpolizisten, was einen gewissen US-Senator Joe Biden zu der süffisanten Äußerung veranlasste: „Die Pentagon-Vision kehrt zu einer alten Vorstellung der USA als Weltpolizist zurück – eine Vorstellung, die nicht zufällig einen großen Verteidigungshaushalt ermöglichen wird“ (The Pentagon vision reverts to an old notion of the United States as the world’s policeman—a notion that, not incidentally, will preserve a large defense budget).
Diese hegemoniale Ausrichtung der US-Außenpolitik setzt sich von Bill Clinton über Bush (jr.) bis Joe Biden unvermindert bis heute und mit wachsender Tendenz fort.
Am 4. Oktober 2001sagte Wolfowitz vor dem Kongress: „Osama bin Laden, Saddam Hussein, Kim Jong Il und alle anderen Tyrannen wollen Amerika aus kritischen Weltregionen heraussehen.“ Die 9/11-Anschläge waren nur ein Beispiel für den Widerstand, dem als Ganzes begegnet werden musste.
„Deshalb ist unsere Herausforderung heute größer, als den Krieg gegen den Terrorismus zu gewinnen“, fuhr Wolfowitz fort. „Die heutige terroristische Bedrohung ist (nur) ein Auftakt für noch größere Bedrohungen.“
Gut zwanzig Jahre danach spielt „the war against terrorism“ kaum mehr eine Rolle. Im Zeitalter der Großmächterivalität fragt unsereiner, ob Wolfowitz ` Voraussage, dass die terroristische Bedrohung nur ein Vorspiel für noch größere Bedrohungen sei, Realität unserer Tage werden könnte. Und genau dieser Frage geht Wertheim nach, als er mit Verweis auf den „vergessenen Irak-Krieg“ und den seit einem Jahr tobenden Ukrainekrieg der Biden-Administration Unredlichkeit vorwirft.
Biden bezeichnete den Ukrainekrieg laut Wertheims Angaben kürzlich als die einzige groß angelegte Invasion, die die Welt seit acht Jahrzehnten erlebt habe. Wörtlich sagte Biden im Februar 2023: „The idea that over 100,000 forces would invade another country—since World War II, nothing like that has happened.“
Er sprach diese Worte ein Monat vor dem 20. Jahrestag der US-Invasion im Irak – einem Krieg, für den der damalige Senator Biden stimmte, wundert sich Wertheim und fügt gleich hinzu: „Der Versuch zu vergessen, ist der einzige Weg, der garantiert, dass man daraus keine Lehren zieht“ (Attempting to forget is the only way to guarantee failing to learn).
Diese Lernunfähigkeit nennt Wertheim „pathologies of primacy“ und „diese Pathologien bringen die USA weiterhin auf Kollisionskurs mit anderen Ländern“ (those pathologies continue to put the United States on a collision course with other countries). Darum könnte „der >nächste Irak< das Format eines Großmachtkrieges annehmen“ (The “next Iraq” could well take the form of a great-power war).
Die „pathologies of primacy“ ignorieren vor allem die Tatsache, dass die anderen Großmächte sich bedroht fühlen und dementsprechend handeln, indem sie dazu tendieren, das Machtgleichgewicht wiederherzustellen. Statt sich dieses Großmächtestreben nach Machtgleichgewicht zu eigen zu machen, tue die US-Außenpolitik ungeachtet der eigenen Machtüberdehnung alles, um diese Tendenz zu bekämpfen (vgl. „these errors force U.S. foreign policy to fight the tendency of power to balance power, just when an overstretched United States needs to harness that tendency“).
Die Folge dieser US-amerikanischen „pathologies of primacy“, welche das Machtgleichgewicht von vornherein ausschließen, sei der Kriegsausbruch in der Ukraine. Wertheims Analyse ist bemerkenswert. Welche Schlüsse zieht er nun daraus? Wie will er vor allem die Gefahr eines „nächsten Iraks“ unterbinden? Ist der Ukrainekrieg bereits der „nächste Irak“ oder vielleicht nur ein Präludium für einen kommenden Großmächtekrieg?
Infolge der Nato-Osterweiterung und der „Open-Door“-Politik bauten die USA sicherheitspolitisch ihre Machtdominanz in Europa aus und „hofften“ dabei, dass Russland nicht feindselig werden würde. „Diese Hoffnung war von Anfang an naiv“ (That hope was naive from the start), beteuert Wertheim.
Dem ist zu entgegnen: Die US-Russlandpolitik war alles andere als „naiv“. Sie setzte von Anfang an auf eine Nato-Expansionspolitik im postsowjetischen Raum. Die Nato-Osterweiterung war die bewusste Entscheidung der Clinton-Administration gegen einen heftigen russischen Widerstand, welche alle nachfolgenden US-Administrationen fort- und umgesetzt haben.5
„Eine Ausweitung der Nato“ – warnte George F. Kennan eindringlich die Clinton-Administration – „wäre der verhängnisvollste Fehler amerikanischer Politik nach dem Ende des Kalten Krieges.“6
Die immer näher an Moskau heranrückende Nato habe nach Wertheims Auffassung Europa geteilt („a dividing line within Europe“) und die in die Nato nicht aufgenommenen Länder „besonders verwundbar“ gemacht. Daraus zieht Wertheim den Schluss, dass die Nato-Expansion auf Kosten der Ukraine und der USA ging (NATO expansion therefore came at the expense of Ukraine – and the United States).
Soll das heißen, dass die Ukraine in die Nato aufgenommen werden müsste, damit keine Teilung Europas stattfindet? Oder dürfte es gar keine Nato-Osterweiterung geben, um „a dividing line within Europe“ zu vermeiden? Und wieso ging die Nato-Expansion zu Lasten der USA? Was meint Wertheim nun genau?
Indem die USA sicherheitspolitisch ihre Machtdominanz in Europa stärkten – schreibt Wertheim -, haben sie ihren europäischen Verbündeten möglich gemacht, ihre Sicherheit nach Washington zu delegieren. Das bedeute aber, dass die USA nicht nur die Ukraine-Hilfe organisieren und ihre eigenen Soldaten und Städte aufs Spiel setzen, sollte Russland die Nato-Länder angreifen wollen. „Der einzige Ausweg aus dieser selbst gestellten Falle“ (The only escape from this self-imposed trap) erblickt Wertheim darin, „mit der Logik des Primats zu brechen“ (to break with the logic of primacy) und die
europäische Verteidigung den Europäern selbst zu überlassen, die „reichlich Ressourcen mobilisieren können, um Russland abzuschrecken und ihr Territorium zu verteidigen“.
Nun ja, die Europäer haben seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer schon ihre Sicherheit an die USA delegiert.
Für eine eigenständige europäische Sicherheitspolitik hat George F. Kennan bereits vor gut vierzig Jahren plädiert, als er geradezu erschrocken den Unwillen Westeuropas diagnostizierte, sich um die eigene Sicherheit zu kümmern: „Westeuropa hat sich seit dem Kriege stärker an uns angelehnt, als auch für Westeuropa selbst gut ist. Wir sind für unsere europäischen Verbündeten zu einer Art Zuflucht geworden. In ihren Augen haben wir sie der Notwendigkeit enthoben, eine eigene Politik … zu entwickeln, was für sie natürlich sehr bequem ist … Ich sehe beispielsweise keinen Grund, warum Westeuropa nicht eine eigene konventionelle Streitmacht aufbauen sollte. In Bezug auf Bevölkerungsgröße und Industriepotential ist Westeuropa den Sowjets zumindest gleichwertig. Dass es nicht die militärische Potenz hat, die es haben sollte, liegt einzig und allein am mangelnden politischen Wollen. Westeuropa hängt viel zu sehr an seinen materiellen Errungenschaften und schätzt seinen Wohlstand viel zu hoch ein, als dass es die notwendigen Opfer bringen könnte. Wenn dem aber so ist, wird die >Finnlandisierung<, falls sie jemals kommt, eine selbstverschuldete Wunde sein.“7
Zwar hat bekanntlich keine „Finnlandisierung“ Westeuropas stattgefunden. Seit George Kennans Äußerung hat sich aber im Wesentlichen auch nichts geändert. Sicherheitspolitisch bleibt die EU nach wie vor das Anhängsel der USA. Noch im Jahr 2004 stellte Ulrich Menzel fest: „Nicht nur sicherheitspolitisch ist Europa Trittbrettfahrer der USA, auch die sozialstaatliche Abfederung des europäischen Paradieses ist nur möglich, weil die USA den Militärausgaben gegenüber den Sozialausgaben mehr Gewicht beimessen“8 und sich die westliche Supermacht nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang im wohlverstandenen Eigeninteresse um die Stabilität der liberalen Weltordnung kümmerte und deswegen das Trittbrettverhalten der europäischen Verbündeten tolerierte.
Diese sicherheitspolitische Bequemlichkeit und/oder Ohnmacht bedeuten aber den Verzicht auf eine eigenständige EU-Geopolitik, was die EU-Europäer von ihrem US-Schutzpatron in jeder Hinsicht nur noch abhängiger macht. Von welcher unabhängigen Verteidigungspolitik Europas träumt Wertheim dann? Sein Plädoyer für eine eigenständige europäische Sicherheitspolitik läuft ins Leere und hat angesichts des tobenden Krieges in Europa erst recht keine Chance auf Verwirklichung.
3. Geoökonomisches Abschöpfungsmodell und seine Gefährdung
Sieht man von der europäischen Verteidigungsbereitschaft und -fähigkeit ab, so stellt sich in der Tat die Frage nach der „logic of primacy“, beklagt Wertheim doch selber stets die „pathologies of primacy“ in der US-Außenpolitik. Was versteht er nun darunter?
Wertheim definiert „the logic of primacy“ im Kontext der europäischen Sicherheitspolitik rein ökonomisch, wenn er von „reichlichen Ressourcen“ Europas spricht, „um Russland abzuschrecken und ihr Territorium zu verteidigen“. Dass die Sicherheitsfähigkeit Europas von seiner ökonomischen Potenz abhängt, ist alles anderes als eine gesicherte Erkenntnis. Diesem Missverständnis unterlag bereits Richard Nixon , als er den Westeuropäern eine Inkongruenz zwischen ihrer „gewaltigen Wirtschaftsmacht“ und ihrer sicherheitspolitischen Ohnmacht vorwarf.9
Wie zu Zeiten des „Kalten Krieges“ besteht nach wie vor eine beinahe hundertprozentige EU-Abhängigkeit von der US-amerikanischen Militärmacht. „Nahezu 100% der Abwehrfähigkeiten gegen ballistische Raketen werden von den USA in die Nato eingebracht. Und natürlich stellen die USA den weit überwiegenden Teil der Fähigkeiten zur Abschreckung“, stellte die ehem. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in ihrer zweiten Grundsatzrede am 17. November 2020 fest.
Es sei eine „Illusion“ – fügte sie hinzu, von der „Idee einer strategischen Autonomie Europas“ zu sprechen, da wir „Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die Nato und ohne die USA“ nicht gewährleisten können.
Bereits 1970 gewann Timothy Stenley (Mitarbeiter McNamaras und ein Advokat amerikanischer Militärpräsenz in Europa) die Erkenntnis, die bis heute nichts an ihrer Gültigkeit eingebüßt hat, dass die europäischen Bündnispartner sich mit der erdrückenden Abhängigkeit von der US-Militärmacht „ein für alle Mal abgefunden hätten und einen dauerhaften >Machtverzicht< übten, der die Minderung der Rolle Europas in der Welt als >irreversibel< erscheinen lasse.“10
Diese Bündnispartnerschaft zwischen Ungleichen brachte schon Mitte der 1960er-Jahre die Einsicht zum Vorschein, dass „Macht … nicht identisch mit Wirtschaftskraft und der Verfügung über materielle Machtmittel (ist). … Die westeuropäischen Staaten haben gemeinsam die Kaufkraft, um Machtmittel zu erwerben, und die Wirtschaftskraft, um sie selbst zu erzeugen. Aber diese Fähigkeiten sind noch keine Macht, sondern nur ein materielles Machtpotential, das erst genutzt und eingesetzt werden muss, damit Macht entstehen kann.“11
Die Verwechslung von „Machtpotential“ und „Macht“ führte die US-Europapolitik schon vor fünfzig Jahren in die Irre und verschleierte nur noch das sicherheitspolitische Vasallitätsverhältnis zwischen zwei ungleichen Bündnispartnern. Denn „die Behauptung, dass wirtschaftliche Expansion und materieller Reichtum die internationalen Machtverhältnisse veränderten und eine >ausgewogene Partnerschaft< zugleich erzwängen und rechtfertigten, wie Nixon und Kissinger dies postulierten, hat nur dann Geltung, wenn die Wirtschaftskraft entweder strategische Autonomie oder fremde Schutzmacht ohne Vorbehalt, ohne Einschränkung, ohne Frist kaufen kann. Weder das eine noch das andere kann das europäische Geld im Verhältnis zu Amerika und der Sowjetunion (ermöglichen). Deshalb ist Westeuropa reich geworden …, aber es ist machtlos und unselbständig geblieben.“12
Nichts hat sich seitdem geo- und sicherheitspolitisch im Verhältnis zwischen den USA und Europa geändert. Und heute will Wertheim uns weismachen, dass die EU-Europäer „reichlich Ressourcen mobilisieren können, um Russland abzuschrecken und ihr Territorium zu verteidigen“? Folgerichtig plädiert er auch am Ende seiner Studie für eine ganz andere, „bessere“ US-Außenpolitik.
Statt immer noch den „pathologies of primacy“ unterworfen und in einer „Untergangsschleife“ (doom loop) gefangen zu sein sowie „von selbstverschuldeten Problemen zu noch größeren selbstverschuldeten Problemen zu taumeln“, müsse Washington sich vom Nahen Osten lösen, die Verteidigungslasten auf die europäischen Bündnispartner verlagern und eine „konkurrierende Koexistenz“ (competitive coexistence) mit China anstreben. Andernfalls hätten die USA von den Erfahrungen mit dem Irak-Krieg nichts gelernt (vgl. the Iraq war remains unfinished business for the United States).
Wertheims Empfehlungen verkennen vollkommen die geopolitische und geoökonomische Großmächtekonstellation der Gegenwart. Richtig an seiner Analyse ist lediglich, dass die Machtüberdehnung infolge der zahlreichen Interventions- und Invasionskriege und einer in deren Folge sündhaften Ressourcenverschwendung (schätzungsweise acht Billionen Dollar) wider Erwarten zu einer Depravierung und nicht zur Festigung und Ausbau der US-Hegemonie geführt hat. Hinzu kommt ein fortschreitender geopolitischer und geoökonomischer Erosionsprozess der US-Hegemonie infolge eines fulminanten Aufstiegs Chinas zu einer geoökonomischen Supermacht und einer militärischen Wiedererstarkung Russlands.
Die von Wertheim empfohlene dreifache Zielsetzung der US-Außenpolitik löst darum kein einziges innen- und außenpolitisches Problem der USA.
Zum einen würde die empfohlene Loslösung vom Nahen Osten zu einer weiteren Dedollarisierung der Weltwirtschaft führen, die sich bereits durch den westlichen Sanktionskrieg gegen Russland beschleunigt hat. Das würde wiederum die Schwächung der geoökonomischen Vormachtstellung der USA in der Welt und dadurch die Aushebelung des „Geschäftsmodell“ mit sich bringen.
Dieses „Geschäftsmodell“ besteht seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und erst recht seit dem Ende des „Kalten Krieges“ in der Abschöpfung des globalen Überschusseinkommens der Weltwirtschaft durch den Dollar dank seiner Weltleitwährungsfunktion. Man könnte es folglich ein geoökonomisches Abschöpfungsmodell nennen, das den USA bis heute ermöglicht, ihren Wohlstand zu mehren und ihre „global primacy“ zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Und dieses Abschöpfungsmodell ist heute akut gefährdet.
Zum anderen würde die Abwälzung der Verteidigungslasten auf die EU-Europäer bei gleichzeitiger Beibehaltung der Nato-Expansions- und „Open-Door“-Politik letztlich die Aufrechterhaltung der Status-quo-Strategie der hegemonialen Dysbalance in Europa bedeuten, was wiederum eine Fortsetzung und nicht Beendigung des Ukrainekonflikts heißen würde.
Zum dritten ist die Forderung nach einer „konkurrierenden Koexistenz“ (competitive coexistence) mit China heutzutage realitätsfern, da zwischen den USA und China spätestens seit der Trump-Administration ein geoökonomischer Bellizismus 13 tobt und nach einem dreitätigen Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Russland am 20./22. März 2023 eine zunehmende geopolitische Konfrontation zwischen einer informellen „Allianz“ China/Russland und dem Westen unter Führung der USA unvermeidbar geworden ist.
Nicht von ungefähr veröffentlichte Donald Kirk kürzlich einen Artikel unter der an Ronald Reagans Spruch anknüpfenden Überschrift „The >evil empire< is morphing into a new Sino-Russian empire“ (The Hill, 20. März 2023).
Mit anderen Worten, im Zeitalter der ausgebrochenen Großmächterivalität geht es den USA nicht so sehr um die „globale Dominanz als Selbstzweck“, als vielmehr um die Rettung von Amerikas „Geschäftsmodell“, das nunmehr akut gefährdet ist, mittels der „globalen Dominanz“.
Dieses „Geschäftsmodell“, dessen Sinn und Zweck in der Abschöpfung vom Überschusseinkommen des globalen Raumes bestehen, ruhte bis jetzt auf zwei Säulen – der vom US-Hegemon dominierten unipolaren Weltordnung und der globalisierten Weltwirtschaft . Es bediente sich im Wesentlichen zwei Herrschaftsinstrumenten des Dollars als Weltleitwährung und der militärischen US-Übermacht.
Dieses Abschöpfungsmodell stößt zunehmend an seine Grenzen und funktioniert nicht mehr so reibungslos, wie es in den vergangenen dreißig Jahren funktionierte. Und so verwundert es nicht, wenn der US-Hegemon versucht, das angeschlagene Geschäftsmodell zu seinen Gunsten und zu Lasten des Restes der Welt zu „modernisieren“.
Nach dem Motto: Zu retten, was zu retten ist, versuchen die USA darum die unipolare Weltordnung – nunmehr als eine sog. „regelbasierte Ordnung“14 umetikettiert – neu zu ordnen und gleichzeitig die globalisierte Weltwirtschaft mittels einer „Decoupling“-Strategie in solch globalen Wirtschaftsstrukturen zu transformieren, die es ihnen ermöglichen würden, die globale Dominanz bzw. „global primacy“ zu retten, um das geoökonomische Abschöpfungsmodell aufrechterhalten zu können.
Bei diesem Transformationsprozess steckt der US-Hegemon allerdings in einem geostrategischen Dilemma. Vor dem Hintergrund des nicht mehr zu leugnenden geopolitischen und geoökonomischen Erosionsprozesses der US-Hegemonie ist die Biden-Administration darum bereit und willig, sich auf eine geoökonomische und militärtechnische Konfrontation mit China (Stichwort Taiwan ) einzulassen und zugleich eine geopolitisch-militärische Eskalation gegen Russland ( in der Ukraine) zu riskieren. Dieser doppelte Kollisionskurs findet dabei, wie eben geschildert, in einem ordnungspolitischen Umfeld statt, in welchem die beiden Ordnungsgefüge der unipolaren Weltordnung und der globalisierten Weltwirtschaft nicht mehr das US-Abschöpfungsmodell vollumfänglich befriedigen können.
Sie büßen zunehmend an Bedeutung ein, weil sie den Funktionsbedingungen der US-Hegemonie nicht mehr genügen. Wird die unipolare Weltordnung tendenziell multipolarisiert und nutzt die globalisierte Weltwirtschaft tendenziell dem geopolitischen Rivalen China mehr als den USA, dann konterkarieren sie unmittelbar die US-Hegemonialstellung und die US-Wettbewerbsfähigkeit.
Die beiden Tendenzen zahlen sich dann für den US-Hegemon nicht mehr aus, sodass er sich gezwungen sieht, einerseits der multipolar werdenden unipolaren Weltordnung entgegenzutreten und deren Funktionsfähigkeit im Sinne der US-Hegemonie wiederherzustellen. Mittels einer Entkopplungsstrategie wird es aber andererseits gleichzeitig versucht, der globalisierten Weltwirtschaft neue Spielregeln aufzuoktroyieren, um den national- und geoökonomischen Wirtschaftsinteressen des US-Hegemonen zu entsprechen.
Das Problem ist nur, dass diese ordnungspolitische Doppelstrategie nicht nur kaum umsetzbar ist, sondern den US-Hegemon auch in ein geostrategisches Dilemma stürzt:
(1) Versucht er die etablierten Spielregeln der globalisierten Weltwirtschaftsordnung durch seine Entkopplungsstrategie zu Gunsten der eigenen nationalökonomischen Wohlfahrtsgewinne zu ändern, gefährdet er seine „hegemoniale Weltrolle“ (the hegemonic world role) als >gütiger< Hegemon und seine monetäre Vormachtstellung als Weltgeldproduzent.
(2) Verzichtet er hingegen auf seine merkantilistisch fundierte Handels- und Finanzpolitik sowie auf den Dollar als Macht- und Sanktionsinstrument, gefährdet er seine nationalökonomischen Wirtschaftsinteressen und nivelliert zugleich sein geoökonomisches Abschöpfungsmodell.
Dieses geostrategische Dilemma führt dazu, dass sich der US-Hegemon im Grunde weder den Selbstverzicht auf seine geopolitische Weltdominanz noch den Verzicht auf die geoökonomische Vormachtstellung leisten kann, da der Verzicht auf nur das eine von beiden die Implosion seines „Geschäftsmodells“ mit sich bringt, womit die US-Hegemonie als solche gefährdet wird.
Das Problem ist nur: Beide Ziele gleichzeitig zu erreichen, kann und wird es nicht geben. Dafür haben sich die geopolitischen und geoökonomischen Rahmenbedingungen für die USA vor dem Hintergrund der erstarkten geopolitischen Rivalen und der zunehmenden Emanzipationsversuche des „Globalen Süden“ dramatisch verschlechtert.
Die einzige Lösung scheint eine permanente Eskalationsstrategie zu sein, begleitet von einer ununterbrochenen, geoökonomischen und geopolitischen Konfrontation zur Erzwingung der eigenen monetären, handels- und sicherheitspolitischen Unverzichtbarkeit im globalen Raum, ohne freilich das unlösbare Dilemma überwinden zu können.
Neigte die Trump-Administrationen eher zu einer geoökonomischen Konfrontation, so schlug das Pendel mit der Biden-Administration in eine andere, geopolitische Richtung aus, ohne freilich auf Trumps „Decoupling“-Strategie ganz verzichten zu wollen.
Wie konnte es dazu überhaupt kommen? Der Aufstieg der Volksrepublik China zu einem mächtigen, ernst zu nehmenden geoökonomischen Akteur, Russlands Wiedergewinnung der militärischen Potenz und dessen Aufstieg zu einem geopolitischen Konkurrenten und schließlich eine monetäre Selbstschwächung bzw. eine finanzielle Selbstüberforderung des US-Hegemonen infolge der zahlreichen militärischen Interventionen und Invasionen zwangen bereits Trumps Regentschaft zu einer geoökonomischen Eskalationsstrategie. Bidens Mannschaft übernahm praktisch nahtlos diese Strategie und baute sie zu einer allumfassenden militärpolitisch fundierten Eindämmungs – und mittlerweile auch Rollback-Strategie (im Ukrainekonflikt) wie zu den alten „schönen“ Zeiten des „Kalten Krieges“ aus.
Der US-Hegemon büßte freilich seine Fähigkeit ein, die Großmächte China und Russland in seine unipolare Weltordnung zu integrieren und dem widerspenstigen „Globalen Süden“ die eigene geopolitische Agenda aufzuzwingen. Das ist der eigentliche Casus knacksus!
Es war auch absehbar, dass es nicht mehr so weiter gehen kann und dass ohne den Paradigmenwechsel in der US-Außenpolitik nicht nur die unipolare Weltordnung und die monetäre Weltdominanz der USA, sondern mittel- bis langfristig auch ihre geoökonomische Vormachtstellung erodieren würde. Die Weltordnung steht am Scheideweg und vor der Gefahr, dass die globalisierte Weltwirtschaft in mehrere, voneinander nur bedingt abhängige wirtschaftliche Machträume zerfallen könnte, die nicht gewillt sind, sich der Pax Americana bedingungslos anzuschließen.
„Die Zeiten der Hyperglobalisierung mögen vorbei sein“ – glaubt Kenneth Rogoff zu wissen -, „aber die Globalisierung lebt.“15 Mag sein! Die Frage ist nur: Wird der seit gut einem Jahr ausgebrochene Sanktionskrieg des Westens gegen Russland und seit der Trump-Administration laufenden Handelskrieg der USA gegen China sowie eine massive militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland für die USA genauso eine Erfolgsstory wie die erfolgreiche Beendigung des „Kalten Krieges“ sein?
Zweifel sind angebracht. Wie witzelte doch derselbe Rogoff (ebd.): „Niemand ist so clever, dass er alles falsch machen kann.“ Der Vorsokratiker Heraklit hätte die Frage auch anderes beantworten können: „Übermut muss man schneller löschen als einen Brand.“
Anmerkungen
1. Näheres dazu Silnizki, M., Die Bekenntnisse eines Neocons. Von der „dangerous naiveté“ in der US-Außenpolitik. 20. März 2023, www.ontopraxiologie.de.
2. Dazu Silnizki, M., Brzezinskis „imperiale Geostrategie“ im Lichte der Gegenwart. Zum Scheitern der US-amerikanischen Russlandpolitik. 9. November 2022, www.ontopraxiologie.de.
3. Stürmer, M., Die Kunst des Gleichgewichts. Europa in einer Welt ohne Mitte. München 2001, 35.
4. Silnizki, M., Posthegemoniale Dysbalance. Zwischen Hegemonie und Gleichgewicht. 31. Mai 2022, www.ontopraxiologie.de.
5. Näheres dazu Silnizki, M., George F. Kennan und die US-Russlandpolitik der 1990er-Jahre. Stellungnahme zu Costigliolas „Kennan’s Warning on Ukraine“. 7. Februzar 2023, www.ontopraxiologie.de.
6. Kennan, G. F., „A Fateful Error“, in: The New York Times, 5.2.1997, S. A23; zitiert nach Greiner, B., Made in Washington. Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben. München 2021, 195, 171.)
7. Gespräch mit Georg F. Kennan, Machtpolitik in Ost und West, in: Urban, G., Gespräche mit Zeitgenossen. Acht Dispute über Geschichte und Politik. Basel 1982, 229-280, 242 f.
8. Menzel, U., Paradoxien der neuen Weltordnung. Politische Essays. Suhrkamp 2004, 113.
9. Vgl. Ruehl, L., Machtpolitik und Friedensstrategie. Einführung General Steinhoff. Hamburg 1974, 163 f.
10. Zitiert nach Ruehl (wie Anm. 9), 176.
11. Ruehl (wie Anm. 9), 176.
12. Ruehl (wie Anm. 9), 177 f.
13. Silnizki, M., Geo-Bellizismus. Über den geoökonomischen Bellizismus der USA. 25. Oktober 2021, www.ontopraxiologie.de.
14. Silnizki, M., Die „regelbasierte Ordnung“ und der „globale Süden“. Zur Frage der nichtwestlichen Perzeption des Ukrainekonflikts. 13. März 2023, www.ontopraxiologie.de.
15. Rogoff, K., „Es geht um die Würde der Demokratie“, in: Handelsblatt vom 11. Januar 2021, 13.