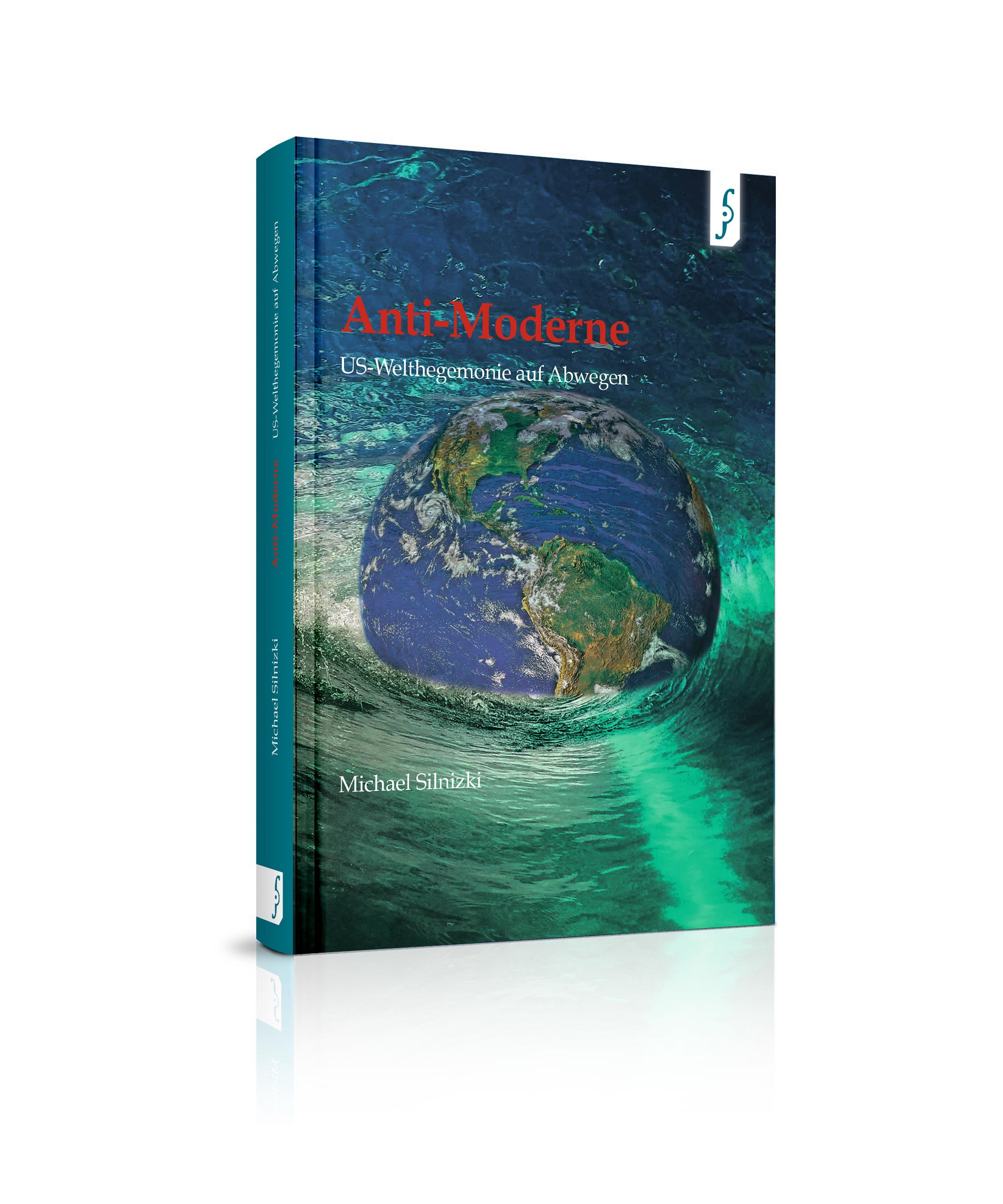Zur Frage nach dem Sinn und Widersinn von „Summit for Democracy“
Übersicht
1. „Global Democracy Strategy“
2. Die gescheiterte Demokratiestrategie im postsowjetischen Raum
Anmerkungen
„Jener, der uns ohne uns geschaffen hat,
kann uns nicht ohne uns retten.“
(Blaise Pascal)
1. „Global Democracy Strategy“
Lässt man die vergangenen drei Jahrzehnte der US-Außenpolitik Revue passieren und liest man die jüngsten Veröffentlichungen der Repräsentanten des außenpolitischen US-Establishments, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass am Stalin zugeschriebenen Spruch etwas dran ist. „Ich habe immer gedacht“ – soll Stalin gesagt haben -, „dass Demokratie die Herrschaft des Volkes ist. Genosse Roosevelt hat mir allerdings klar gemacht, dass Demokratie die Herrschaft des amerikanischen Volkes ist.“
Getreu diesem Spruch fordert Jon Temin in seinem Artikel „The U.S. Doesn’t Need Another Democracy Summit“ (Foreign Affairs, 27. März 2023) einen Plan zur Bekämpfung des Autoritarismus („It Needs a Plan to Confront Authoritarianism“). Statt am 29. März 2023 seinen zweiten Demokratiegipfel einzuberufen, sollte Joe Biden lieber eine Strategie zur Verteidigung und Förderung der Demokratie entwickeln, kritisiert Temin.
Denn ein neuer Bericht des Forschungsinstituts Varieties of Democracy lege nahe, dass 72 Prozent der Weltbevölkerung heute gegenüber 46 Prozent im Jahr 2012 in Autokratien leben. Und Freedom House habe 2022 zum siebzehnten Mal in Folge einen globalen Niedergang der Demokratie diagnostiziert.
Die Biden-Administration sei sich zwar – beschwichtigt Temin – der Kluft zwischen der hochtrabenden Rhetorik und der realen US-Außenpolitik bewusst und habe versucht, sie mit Programmen zur Unterstützung demokratischer Reformer zu schließen. All das sei aber nichts weiter als ein Politikersatz (substitute for policy).
Was die Biden-Administration benötige, sei eine globale Demokratiestrategie (global democracy strategy), um die bürokratische Entscheidungsfindung zu steuern und ihre Politik und Programme an klar festgelegten Prioritäten auszurichten.
„Die Strategie sollte“ – fordert Temin – „nicht nur die Prioritäten der Verwaltung darlegen, sondern sie auch in Entscheidungsstrukturen einbetten, damit sie nicht ignoriert werden können, wenn sie unbequem erscheinen. Zu diesem Zweck sollte die Verwaltung dauerhafte Maßnahmen ergreifen, wie z. B. eine jährliche Strategieüberprüfung und die Schaffung eines Aufsichtsrats zur Prioritätenfestlegung. Die Strategie muss auch Richtlinien empfehlen, die Reaktionen auf Bedrohungen der demokratischen Regierungsführung bestimmen. Wenn beispielsweise ein ausländischer Staatschef seine Amtszeit abschafft oder verlängert, um im Amt zu bleiben, sollten die Vereinigten Staaten automatisch einige Hilfeleistungen aussetzen, wie sie es bei Militärputschen tun. Schließlich sollte die Strategie klarstellen, welche Behörde oder Abteilung die Gesamtverantwortung dafür trägt, dass die Demokratie im Mittelpunkt der außenpolitischen Entscheidungsfindung steht“ usw. usf.
Was Temin hier empfiehlt, ist im Grunde die Errichtung einer global agierenden US-amerikanischen Verwaltungsinstanz zur Förderung und Verteidigung der Demokratie. Vergeblich glaubte unsereiner, dass sich die seit dreißig Jahren andauernde und zum Teil gewaltsam durchgeführte US-Demokratisierungsstrategie dem Ende zuneigt und die „glorreichen“ Zeiten der vom US-Hegemon propagierten „Demokratieförderung“ endgültig vorbei sind. Selbst ein solch strammer Neocon wie Max Boot hat diesem Ansinnen kürzlich in seinem Beitrag „What the Neocons Got Wrong“ für Foreign Affairs (10. März 2023) abgeschworen.
Doch weit gefehlt! Mit neuem Elan geht Temin an die Sache ran. Was er hier erneut propagiert, ist die längst gescheiterte Amerika-zentrierte unipolare Weltordnung mit ihrer Missionierung von Demokratie und Menschenrechten. Diese Idee fixe artete schon längst in eine „Weltgewaltordnung“ (Karl Otto Hondrich )1 aus, die zu Ende gedacht auf einen Weltüberwachungs- bzw. Weltunterwerfungsstaat hinausgelaufen hat.
Und dieser Leviathan sollte nach Temins Vorstellungen nach wie vor die Demokratisierungsprozesse weltweit steuern, fördern, überwachen und kontrollieren dürfen!? Offenbar ignoriert die von Jon Temin empfohlene „globale Demokratiestrategie“ immer noch zwei grundlegenden Ordnungsprinzipien der internationalen Beziehungen: das Souveränitäts- und das staatenzentrierte Organisationsprinzip der Weltgemeinschaft.
Im Zeitalter der (noch) bestehenden, nicht desto weniger aber längst erodierenden unipolaren Weltordnung unter Führung des US-Hegemonen sieht Temin in der staatlichen Souveränität einen schlichten Anachronismus und die Staatenwelt mit ihrer kleinräumigen Parzellierung des globalen Raumes lediglich ein vernachlässigendes Organisationsprinzip der Weltgemeinschaft, das der grenzüberschreitenden US-Demokratieförderung entgegensteht.
Seine „globale Demokratiestrategie“ läuft letztlich auf die Errichtung eines das Souveränitätsprinzip überflüssigmachenden Weltstaates als der überstaatlichen letzten Instanz hinaus. „Zwischen souveränen Staaten kann es“ aber – belehrte uns Hannah Arendt einst – „keine letzte Instanz geben außer Krieg“.2 Wir haben dann entweder halbsouveräne oder gar keine souveränen Vasallenstaaten mehr.
„Die eigentliche Schwierigkeit“ – fügte Arendt hinzu – „ist ja, dass die letzte Instanz nicht überstaatlich sein darf. Eine überstaatliche Instanz würde entweder wirkungslos sein oder von dem jeweils stärkeren monopolisiert werden und so zu einem Weltstaat führen. Das dürfte wohl das tyrannischste Gebilde sein, das sich überhaupt denken lässt, vor dessen Weltpolizei es dann auf der ganzen Erde kein Entrinnen mehr geben würde, bis es schließlich auseinanderfällt.“3
Ohne das gewusst zu haben, wie vorausschauend ihre Äußerung ist, hat Arendt im Grunde eine theoretische Grundlage für die Untragbarkeit einer unipolaren Weltordnung geliefert, die früher oder später zwingend auseinanderfallen wird. Denn diese unipolare Weltordnung gleicht einem „irregulären und einem Monstrum ähnlichen Körper“ („irregulare aliquod corpus et monstro simile“), wie Samuel Pufendorf einst das Heilige Römische Reich Deutscher Nation bezeichnete.
Dieses „Monstrum“ entzieht sich de facto jeder völkerrechtlichen Rechtfertigung seines Tuns und Wirkens, handelt nach eigenem Gutdünken und tritt als eine überstaatliche Zentralinstanz auf. In die innerstaatlichen Entscheidungsprozesse eingreifend, maßt es sich an, Demokratievorgaben machen zu müssen und diese im Wege einer hegemonialen Bevormundung zu oktroyieren.
Die Folge dieser dann als „demokratisch“ verklärten US-Hegemonie ist das Absinken der demokratischen Partizipation einer jeden staatlich organisierten Bürgergesellschaft auf das Niveau eines Befehlsempfängers, der seine Direktive von der hegemonial administrierten supranationalen Instanz zu empfangen hat. Hegemonie wird hier als „Demokratie“ ausgegeben bzw. „demokratisch“ verklärt und das Volks- und Staatssouveränitätsprinzip entwertet, umdefiniert und seines ursprünglichen Sinngehalts beraubt.
Bereits 2002 stellte Ingeborg Maus klar, „dass eine Demokratie, die den Namen noch verdient, in supranationalen Großräumen oder gar in einem Weltstaat nicht mehr organisiert werden kann.“4 Zwar etabliert „das Prinzip starrer Staatsgrenzen“ durch „territoriale Einhegung einen politischen Partikularismus“, der in Anbetracht der faktischen Entgrenzung jeder geo- und weltpolitischen Agenda durch die Globalisierung der ökonomischen, technologischen und informationsbezogenen Macht „zum schlichten Provinzialismus“ (ebd.) degeneriert.
Diese Feststellung orientiert sich aber an einem substantialisierenden Verständnis vom Nationalstaat, das den Zusammenhang von Land und Herrschaft impliziert. Im Zeitalter der Volkssouveränität ist ein demokratisch und liberal verfasster Verfadsungsstaat durch die Substituierung des Territorialprinzip durch das Prinzip des Personenverbandes bestimmt. Diese Entsubstantialisierung bzw. Entterritorialisierung der demokratisch verfassten Staatsgesellschaft führt zur Entgrenzung des Demokratieverständnisses und birgt in sich die Gefahr einer gleichzeitigen Entgrenzung des staatlichen Souveränitätsprinzips.
Diese Vermengung der zwei völlig unterschiedlichen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Ordnungsprinzipien ermöglichen dem US-Hegemon das staatliche Souveränitätsprinzip durch die Abstraktionen des demokratischen Legitimationsprinzips auszuhebeln. Ist das demokratische Legitimationsprinzip entgrenzungsfähig, so unterliegt das Souveränitätsprinzip der Staatenwelt ganz anderen, nämlich traditionsgebundenen bzw. verfassungsgeschichtlich fundierten Beständen einer konkreten und nicht abstrakt existierenden politischen und sozialen Ordnung.
So gesehen, steht das verfassungsgeschichtlich gebundene staatliche Souveränitätsprinzip im Konflikt zum universal formulierten und von der konkreten politischen und sozioökonomischen Realität losgelösten Demokratieverständnis. Je nachdem, welches der beiden Ordnungsprinzipien dominiert, hängt davon auch die Erfolgschance einer „globalen Demokratiestrategie“ ab. Diese führt freilich nicht so sehr zu mehr Demokratie, als vielmehr zu mehr Einfluss des US-Hegemonen auf die seinem Demokratiediktat unterworfenen Länder und Völker.
Durch eine „globale Demokratiestrategie“ wäre dann der Zusammenhang von Souveränitäts- und Demokratieprinzip nach zwei Richtungen hin aufgehoben: Die traditionsgebundene und verfassungshistorisch bedingte Konkretisierung des „universalistischen“ Demokratieverständnisses und die Fähigkeit zur Selbstorganisation der Staatsgesellschaft würden gleichermaßen durch die globale, die staatliche Souveränität transzendierende überstaatliche Zentralinstanz usurpiert. Die Oktroyierung der „demokratisch“ verklärten Entscheidungsmechanismen durch eine einzige globale Zentralinstanz bedeutet aber die Isolierung und Zerstörung der demokratischen Selbstorganisation eines jeden Staatsvolkes. Und so könnten die USA in die innerstaatlichen Prozesse eingreifen und der Staatenwelt jederzeit ihre Lesart von Demokratie und Menschenrechten gegen die dort vorherrschenden Lesarten oktroyieren.5
2. Die gescheitete Demokratiestrategie im postsowjetischen Raum
Aus ganz anderen Gründen kritisiert auch Anatolij Antonov (der russ. Botschafter in den USA) Joe Bidens zweite „Summit for Democracy“. „Der russische Gesandte warnt vor >extrem gefährlichen< Ideen hinter dem US-Demokratiegipfel“ (Russia Envoy Warns ‚Extremely Dangerous‘ Ideas Behind U.S. Democracy Summit) überschreibt Tom O’Connor sein Bericht über ein Gespräch mit Antonov in Newsweek am 27. März 2023.
Mit Verweis auf „eine Reihe von westlichen Beobachtern“ bezeichnet Antonov den „Gipfel für Demokratie“ als „den Inbegriff der Heuchelei“ („the epitome of hypocrisy“), spricht Washington in Anbetracht von vielen politischen und sozialen Problemen im eigenen Land „das moralische Recht“ ab, anderen seine Regeln und Lebensweise aufzuzwingen.
„Viele fragen sich“ – so Antonov -, was Washington mit seiner Veranstaltung überhaupt bezweckt und welchen Mehrwert sie „für die demokratischen Weltstandards“ (world standards in democracy) mit sich bringt, zweifeln doch selbst einige „Dissidenten“ unter den Gipfelteilnehmern die Legitimität der USA an, der „democratic community“ die amerikanischen Werte und Standards aufzuoktroyieren.
„Wie können dann überhaupt die nationalen Unterschiede in Kultur, Geschichte und Religion berücksichtigt werden?“, fragt er und fordert getreu dieser Logik Respekt vor der Vielfalt der Kulturen und Zivilisationen (respect for the diversity of cultures and civilizations). Es sei äußerst gefährlich, die Idee von eigener Exklusivität zu kultivieren („It is extremely dangerous to cultivate in people the idea of their exclusivity“), warnt Antonov.
„Es gibt keine perfekten Länder“, fährt er fort. Der Schutz der Menschenrechte sei darum kein ausschließliches Vorrecht des Westens (Human rights protection is not the exclusive prerogative of the West). Demokratie baue nicht auf Vorschriften auf, sondern sei ein Produkt der inneren Entwicklung einer konkreten Gesellschaft. Wir haben ja die desaströsen Folgen der Versuche gesehen, die amerikanische Demokratie gewaltsam in den Irak, Libyen und Afghanistan zu exportieren.
Und so äußert Antonov am Ende des Gesprächs seine feste Überzeugung, „dass die Versuche, die Menschenrechtsdoktrin zu benutzen, um geopolitische Spiele zu spielen, die Souveränität der Staaten zu zerstören und die westliche politische, finanzielle, wirtschaftliche und ideologische Dominanz zu rechtfertigen, aufhören sollten“ (I am convinced that the attempts to use the human rights doctrine to play geopolitical games destroying sovereignty of States and to justify Western political, financial, economic and ideological dominance should cease).
Man spürt in diesen Worten, wie sehr der russische Botschafter aus seiner eigenen Erfahrung mit Demokratisierungsprozessen im postsowjetischen Russland spricht und wie verbittert er darüber ist, was er auch selber nicht verschweigt. „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion versuchten die westlichen Kollegen in den 1990er-Jahren im Gespräch mit uns das Prinzip der Menschenrechte auf jede erdenkliche Weise verabsolutieren, um ein konkretes politisches Ziel zu erzielen“.
„Russland war gezwungen, die Standards des Staatsaufbaus und der Regierungsführung zu akzeptieren, die für den Westen von Vorteil waren, aber ernsthafte Verluste für unser Land bedeuteten.“
„Wir haben daraus Konsequenzen gezogen“, betonte Antonov abschließend.
Betrachtet man nun einen verfassungspolitischen Transformationsprozess im postsowjetischen Raum der vergangenen dreißig Jahre, so stellt man in der Tat fest, dass die verfassungsideologische Expansionspolitik des Westens einen grandiosen Schiffbruch erlitten hat und auf der ganzen Linie gescheitert ist.
Unter dem irreführenden Schlagwort „Demokratieförderung“ durchgeführt, musste dieses ideologische Expansionsabenteuer allein schon deswegen ins Leere laufen, weil das erwachte Nationalbewusstsein der zahlreichen Völker im postsowjetischen Raum von einer deterministischen und nicht voluntaristischen Natur war, von der fehlenden neuzeitlichen Rechts- und Verfassungstradition ganz zu schweigen. Die verfassungsideologische Offensive des Westens hinterließ nur eine ideologische Schneise der Verwüstung in dem tradierten Leben dieser Völker und konnte keine liberale verfassungspolitische Erneuerung in Gang setzen.
Der Übergang zu einem liberalen Rechts- und Verfassungsstaat ist aber „gerade dadurch bestimmt, dass das Territorialprinzip im Ganzen durch das des Personenverbandes ersetzt wird“ und dass dieser „Austausch von Prinzipien den modernen Staat“ erst konstituiert.6 Ein „moderner Staat“ ist nämlich nicht „eine Habe“ (Kant), ein Territorium, auf dem Menschen „als bloße Anhängsel des Bodens zu behandeln (sind), die mit diesem erworben oder veräußert werden können.“7
Der „moderne Staat“ ist ein Verbund von Menschen, dessen Entscheidungsprozesse sich in einem institutionalisierten Verfahren äußern, welche die Bürger erst dann als legitim erachten, wenn sie zuvor als Mitentscheider des institutionalisierten Verfahrens auftreten können. Der Wandel vom totalitären Einheitsstaat zu einem demokratisch und liberal verfassten Verfassungsstaat schlug im postsowjetischen Raum allein schon deswegen fehl, weil die abgespalteten Sowjetrepubliken sich primär als Territorial-und nicht als Personenverbände konstituierten.
Dass diese neu geschaffenen Territorialstaaten nach wie vor den Traditionsbeständen wie Abstammung, Schicksalsgemeinschaft oder archaischen Machtstrukturen verhaftet sind und darum per definitionem zu einer Entgrenzung ihres nationalstaatlichen Identitätsbewusstseins weder fähig noch willig sind, war und ist das eigentliche Kernproblem des postsowjetischen Raumes. Dazu kamen die geopolitisch motivierten Versuche des Westens, seine Lesart von Demokratie und Liberalität zu oktroyieren, was die innerstaatliche Selbstlegitimation der Bürgergesellschaft konterkarierte.
Der westlichen Verfassungsideologie mit ihrer „Entsubstanzialisierung des neuen nationalstaatlichen Identifikationsangebots“8 stand eben diese traditionelle und ethnisch gefärbte Entgrenzungsunwilligkeit des postsowjetischen, nationalen Identitätsbewusstseins entgegen, was zum Scheitern der verfassungsideologischen Expansionspolitik des Westens führen musste und auch geführt hat.
Indem alle tradierten Inhalte einer verfassungspolitischen Integration des vormodernen Europas durch das neuzeitliche Legitimationsprinzip aufgerieben wurden und an ihre Stelle Verfahren traten, in denen über Inhalte unter Beteiligung der Staatsbürger erst entschieden wird, bezeichneten die nationalstaatlichen Grenzen nichts anderes als die Geltungsgrenzen dieses neuen Legitimationsprinzips und der auf dessen Grundlage zustande gekommenen Verfassungsordnung. „Grenzen dieser Art sind aber von vornherein auf Grenzüberschreitungen hin angelegt“ (ebd.).
Der immer wieder stattfindende Versuch einer Sprengung der nationalen und kulturellen Identitätsgrenzen des postsowjetischen Raumes mittels der grenzüberschreitenden, sprich: „globalen Demokratiestrategie“ ist deswegen nichts anderes als eine andere Art des verfassungspolitisch fundierten, westlichen Expansionismus zwecks Oktroyierung der vom Hegemon universalideologisch festgelegten Welt- und Wertordnungsentwürfe, um anschließend den eigenen geopolitischen und geoökonomischen Machtwillen einfacher durchsetzen zu können.
Da aber das postsowjetische Identitätsbewusstsein raumgebunden, nicht entgrenzend und darum gegenüber dem Entgrenzungszwang der westlichen Verfassungsideologie immun ist, kann sich die verfassungspolitische Expansion des Westens gen Osten „Erfolg“ nur mit Gewalt verschaffen.
Würde eine solche verfassungspolitisch „erfolgreiche“ Eroberung des postsowjetischen Raumes gelingen, dann würde nicht so sehr ein Rechts- und Verfassungsstaat etabliert, als vielmehr dessen Fassade, was wir im Übrigen heutzutage am Beispiel der Ukraine nach 2014 beobachten dürfen.
Diese (ukrainische) Fassade wurde zu einer jeglicher liberalen Verfassungssubstanz entleerten Machtkonstruktion, welche die oktroyierten Verfassungsvorstellungen nach außen bloß imitiert, nach innen aber weder in der Lage noch gewillt ist, ihnen Folge zu leisten. Diese bloße Imitation geht zum einen mit Verlust der eigenen kulturellen Identität einher, ohne dass sich die oktroyierten Verfassungsvorgaben etablieren (können), und wirkt sich zum anderen destruktiv auf die traditionellen Lebensstrukturen aus, nachdem sie die eigene historisch-gewachsene Tradition für disponibel erklärt hat.
Die historisch-gewachsenen Macht- und sozialen Strukturen lassen sich im Sinne der westlichen Verfassungsideologie bzw. der globalen US-Demokratiesteuerung von außen weder transformieren noch reformieren noch gewaltsam zerschlagen, sondern nur manipulieren , da diese kraft ihrer Eigengesetzlichkeit bestehen können und genügend Abwehrkräfte besitzen, um Widerstand leisten zu können. Weil aber das postsowjetische Identitätsbewusstsein raumgebunden und darum von defensiver Natur ist, kann es zwar die verfassungspolitische Expansion des Westens abwehren, aber keinen verfassungsideologischen Gegenentwurf zur westlichen Verfassungsideologie propagieren und bleibt darum außerhalb des eigenen Kulturraumes kraft- und wirkungslos. Der einzige ideologische Ansatz besteht allein auf das Beharren des staatlichen Souveränitätsprinzip, das jedwede grenzüberschreitende „globale Demokratisierungsstrategie“ von sich weist.
Resümierend können wir festhalten, dass der Versuch einer Implementierung des westlichen Demokratiemodells in den nichtwestlichen Macht- und Kulturräumen selbst mittels militärischer Gewalt bestenfalls eine Imitation desselben bewirken kann. Diese Erkenntnis findet zunehmend und mit wachsender Tendenz ihren Niederschlag auch in einzelnen US-Publikationen wieder, wie man jüngst in dem Artikel von Jennifer Kavanagh und Bryan Frederick unter der bezeichnenden Überschrift „Why Force Fails. The Dismal Track Record of U.S. Military Interventions“ (Warum Gewalt versagt.Die düstere Bilanz der US-Militärinterventionen) in Foreign Affairs vom 30. März 2023 nachlesen kann.
Anmerkungen
1. Silnizki, M., Im Würgegriff der Gewalt. Wider Apologie der „Weltgewaltordnung“. 30. März 2022, www.ontopraxiologie.de.
2. Arendt, H., Macht und Gewalt. München Zürich 1985, 130.
3. Arendt (wie Anm. 2), 131.
4. Maus, I., Vom Nationalstaat zum Globalstaat oder der Verlust der Demokratie (2002), in: ders., Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie. Berlin 2011, 375-406 (377).
5. Vgl. Maus, I., Der zerstörte Zusammenhang von Freiheitsrechten und Volkssouveränität in der aktuellen nationalstaatlichen und internationalen Politik (1999), in: ders., Über Volkssouveränität (wie Anm. 3), 359-374 (374).
6. Maus (wie Anm. 4), 378.
7. Maus (wie Anm. 4), 379.
8. Maus (wie Anm. 7).