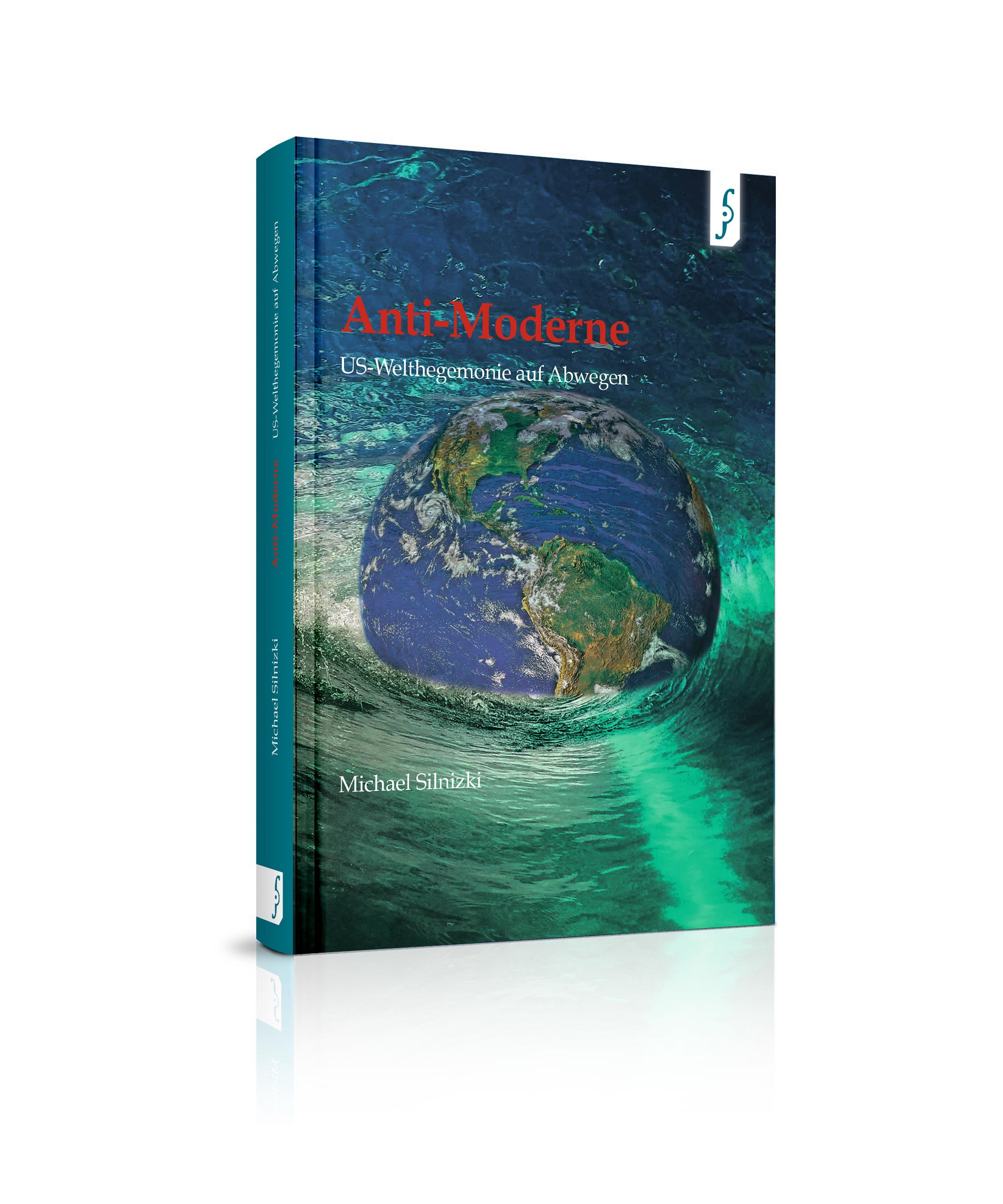Zur Aktualität der Entspannungspolitik der 1970er-Jahre
Übersicht
- Zur Frage nach einer anderen Außenpolitik
- Nixons Außenpolitik als Blaupause oder als Fata Morgana?
(a) Entspannungspolitik als Stabilitäts- und Friedenspolitik
(b) Menschenrechtspolitik versus Friedenspolitik - Neues Machtgleichgewicht oder das alte Hegemoniestreben?
(a) Im Widerstreit zwischen Wahrscheinlichem und Wünschbarem
(b) Globale Gleichgewichtspolitik als Entspannungspolitik
Anmerkungen
1. Zur Frage nach einer anderen Außenpolitik
Die Zeit ist reif geworden, nach dem Afghanistan-Abzug über eine andere Außenpolitik im Still der Entspannungspolitik eines Richard Nixon nachzudenken. Weder die marktschreierische Ankündigung von „Europas Anti-China-Strategie“ noch kraftmeierische Forderungen nach Allianzen-Bildung „mit gleichgesinnten Staaten, um dem Machtstreben Pekings entgegenzuwirken“1; weder die Fortsetzung der wirkungslosen Sanktionen gegen Putins „Autokratie“ noch deplatzierte Drohgebärde an die Adresse der Russländischen Föderation ist heute das Gebot der Stunde.
Die Zeit ist reif für die Frage nach einer anderen Außenpolitik gegenüber einer ökonomischen Supermacht China wie auch gegenüber einem militärisch erstarkten Russland.
Dreißig ereignisreiche Jahre sind seit dem Ende des „Kalten Krieges“ und dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums vergangen, ohne dass der „Geist“ des „Kalten Krieges“ ganz verschwunden ist. Diese langen dreißig Jahre waren geprägt durch einen noch nie dagewesenen Angriff auf die USA als die einzig verbliebene Supermacht, den fulminanten Aufstieg Chinas zu einer geoökonomischen Supermacht, ein wie ein Phönix aus der Asche auferstandenes Russland, das erneut (spätestens seit der sog. „Ukraine-Krise“) zu einem geopolitischen Rivalen des Westens mutiert ist, und nicht zuletzt durch die zahlreichen brutal und gnadenlos geführten „humanitären Interventionen“ der NATO unter Führung der USA. Wie „der Idealismus in Imperialismus aus(artet)“2, so artete die westliche bzw. die US-amerikanische Missionierung von Demokratie und Menschenrechten mit ihrem universalen Geltungsanspruch in den vergangenen zwanzig Jahren allmählich und unaufhaltsam in einen bellizistischen Hegemonismus aus.
Am Ende dieser wilden und einzigartigen, Epoche machenden Zeit stellt man erstaunt fest, dass die US-amerikanische Außenpolitik der Gegenwart groteske Züge angenommen hat. Sie handelt immer noch im „Geiste“ des „Kalten Krieges“, obschon der „Kalte Krieg“ selber längst der Vergangenheit angehört, und leidet unübersehbar unter einem schwindelerregenden Eskapismus. Der in seinem messianischen Sendungsbewusstsein gefangene US-Hegemon hofft einerseits immer und immer wieder mit seinem „militanten Humanismus“ (Noam Chomsky)3 „durch den Sieg endlich und endgültig das Prinzip des Bösen auszumerzen – das Böse, das an so vielen Katastrophen schuld ist“4. (Offenbar stimmt das Bonmot immer noch: „Wenn man lange genug an einem Amerikaner kratze, kommt der Erlöser (redeemer) zum Vorschein.“5)
Andererseits befindet der Hegemon sich mit seinen weltpolitischen Aktivitäten in einem unauflösbaren Dilemma, das zwischen einer geopolitischen Großmachtmanie, einem geoökonomischen Macht- und einem außenpolitischen Realitätsverlust schwankt. Der Hegemon ist der Gefangene seiner selbst geworden und kann sich nicht ohne Weiteres aus dieser Selbstgefangenschaft befreien. Denn dieses Selbstgefangenendilemma ist ebenso ein unlösbares wie unzeitgemäßes Unterfangen:
(1) Verzichtet er ganz oder „nur“ teilweise auf die etablierten Spielregeln der bestehenden Welt(wirtschafts)ordnung zwecks Überwindung des entstandenen geoökonomischen Machtverlustes, gefährdet er seine geopolitische Vormachtstellung und die darauf gegründete monetäre Stellung als Weltgeldproduzent.
(2) Verzichtet er hingegen auf die Beseitigung des eigenen geoökonomischen Erosionsprozesses, kann er das selbstgestellte Ziel abschreiben, die Ungleichgewichte im Außenhandel abzubauen, mit der Konsequenz einer weiteren Zunahme von Importüberschüssen, eines weiteren Ausbaus seiner Schuldnerposition und zuallerletzt eines weiteren Beschäftigungsrückgangs im Inland.
Der US-Hegemon kann sich heute im Grunde weder einen Selbstverzicht auf seine geopolitische Weltdominanz noch einen Verzicht auf die eigenen wohlfahrtsstaatlichen Interessen leisten. Beide Ziele gleichzeitig zu erreichen, kann und wird es freilich nicht geben. Aus dieser ausweglosen Position ergibt sich das Selbstgefangenendilemma: Der Austritt aus der Verantwortung als Hegemon schmälert seine geopolitische Vormachtstellung im globalen Raum; das Verharren in dieser Stellung gefährdet wiederum die in Rede stehende geoökonomische Zielsetzung seiner Geopolitik. Die bisherige Außenpolitik des >Weiter so< (d.h. weiterhin eine permanente geoökonomische und ideologische Eskalation zur Erzwingung der eigenen geopolitischen und geoökonomischen Unverzichtbarkeit im globalen Raum, ohne freilich das unlösbare Dilemma überwinden zu können) endet unweigerlich in eine Sackgasse. Sie gefährdet zudem den Weltfrieden und hat keine Zukunft mehr.
2. Nixons Außenpolitik als Blaupause oder Fata Morgana?
(a) Entspannungspolitik als Stabilitäts- und Friedenspolitik
Ausgerechnet der Kalte Krieger Richard Nixon war der erste und der letzte US-Präsident nach 1945, der eine außenpolitische Alternative zur Eindämmungspolitik entwickelte und teilweise auch umsetzte. Das war ein Kraftakt sondergleichen. In den amerikanischen Eliten herrschte – merkte Henry Kissinger einst spöttisch an – eine außenpolitische Stimmung vor, die entweder von der Theologie oder von der Psychiatrie vorgegeben wurde und folgerichtig „geopolitische Erwägungen ganz einfach ausschloss“. „Die Väter der >containment<-Politik – Acheson, Dulles und ihre Kollegen“ – fuhr er fort – „hatten . . . ihr Werk ausschließlich mittels theologischer Kategorien konzipiert.“6
Heute konzipiert man die Russlandpolitik lieber mittels der Universalideologie von Demokratie und Menschenrechten, verschweigt aber geflissentlich, dass eben diese Universalideologie gleichzeitig auch eine geopolitische Wirkung ausüben kann und auch ausgeübt hat, wie zahlreiche sog. „Farbenrevolutionen“ im postsowjetischen Raum zeitigten.
Die Universalideologie schließt heute die geopolitischen Erwägungen nicht aus, sondern verschleiert sie. Die ideologische Rhetorik camoufliert vielmehr die geopolitischen und geoökonomischen Intentionen der westlichen Russland- und China-Politik.
„Da man den Sturz der Sowjets als Hauptaufgabe amerikanischer Außenpolitik betrachtete“ – so Kissinger (ebd.) -, „waren umfassende Verhandlungen, ja selbst ein entsprechender diplomatischer Plan, so lange zwecklos (wenn nicht gar unmoralisch), wie eine >Position der Stärke< keinen Wandel ihrer Absichten herbeiführte.“ Die Ost-West-Beziehungen waren also zurzeit der Regierungsübernahme durch die Nixon-Administration „in eine Sackgasse geraten. Die traditionelle Eindämmungstheorie hatte eine diplomatische Pattsituation herbeigeführt“7. Diese Pattsituation erforderte laut Kissinger eine neue, sich auf ganz andere Grundlage fußende Außenpolitik. An die Stelle einer „totalen Konfrontation (im Sinne der >Theologen<)“ oder „totalen Versöhnung (wie die >Psychiater< forderten)“ sollte nach der Nixon-Doktrin „das nationale Interesse als maßgebliches Kriterium für eine langfristige amerikanische Außenpolitik“8 treten.
Die Nixon-Administration ging von einem realpolitischen und ideologiefreien Leitgedanken aus, dass die Verfassungsordnung der Großmächte als legitim erachtet und deren Existenz getreu dem Motto anerkannt wird: „Nicht der Kommunismus, sondern die internationale Anarchie sei die größte Gefahr“9.
Vor diesem Hintergrund hat Nixon seine Überlegungen in einem Pressegespräch auf Guam am 24. Juli 1969 dargelegt, die zu einem amtlichen Dokument der amerikanischen Regierung erhoben und offiziell als „Nixon-Doktrin“ verkündet wurden. Sie formulierte drei um den Begriff des Friedens zentrierten Maximen, die die US-Außenpolitik prägen sollten: Partnerschaft – Stärke – Verhandlungsbereitschaft 10. Der Frieden sei zwar nicht alles, ohne Frieden sei aber alles nichts. Die auf Partnerschaft, Stärke und Bereitschaft zum Verhandeln basierende Vision von Frieden ist der rote Faden, der sich durch den Bericht des US-Präsidenten Richard M. Nixon an den Kongress vom 18. Februar 1970 über die amerikanische Außenpolitik für die 1970er-Jahre zieht.
Weder die Missionierung der sog. „westlichen Werte“ noch die Oktroyierung von Demokratie und Menschenrechten den wertfremden Kultur- und Machträumen notfalls mittels des „militanten Humanismus“ steht im Zentrum der „Nixon-Doktrin“, sondern eben eine Vision von Frieden, die allein auf Verhandlungswege erlangt und erzielt werden sollte.
Diese Friedensvision scheint heute in Anbetracht der stattgefundenen zahlreichen blutigen Invasionen und farbigen Revolutionen und angesichts der erbittert geführten Großmächterivalität offenbar kein vorrangiges Ziel der US-amerikanischen und westeuropäischen Außen- und Geopolitik mehr zu sein. „Vernunft des nuklearen Friedens“ (zurzeit des Kalten Krieges) scheint heute vergessen bzw. irrelevant geworden zu sein. Die Zeiten haben sich geändert. Der Triumphalismus des Westens kennt nach der siegreichen Beendigung des Kalten Krieges keine Grenzen mehr.
Die bipolare Weltordnung, in der die Supermächte noch „in den Abgrund“ schauten und darin „die Trümmer ihrer eigenen Existenz“ sahen, gibt es nicht mehr. Das „aus Furcht und Vernunft“ entstandene bipolare System, das Raymond Aron in den Worten fasste: >Friede unmöglich, Krieg unwahrscheinlich<, erzwang „den langen nuklearen Frieden“11. Nixons Entspannungspolitik hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Und heute? Der Frieden steht offenbar nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste der westlichen Außenpolitik. Ist der Westen vielleicht zu selbstsicher und zu übermütig geworden? Will er keinen „langen Frieden“ mehr? Wohl kaum! Die Gründe liegen woanders. Der Westen hat heute die Sorge vor einem langfristigen Trend, der die jahrhundertelang andauernde geopolitische und geoökonomische Vormachtstellung der westlichen Hemisphäre erodieren lässt.
Diese Sorge überlagert jede Angst vor einer Weltfriedensgefährdung und macht den Westen umso mehr ideologisch und geoökonomisch aggressiv, je weniger er fähig und in der Lage ist, sich auf eine militärische Konfrontation gegen die Großmächte China und Russland einzulassen. Eine ideologische und geoökonomische Eskalation kann allerdings unter bestimmten Umständen auch in einen militärischen Konflikt ausarten. An echten Verhandlungen, die weder anmaßende nochoberlehrerhafte Belehrungen sind, führt aber kein Weg vorbei. Weder das „moralische Athletentum“ noch ein „steriler Moralismus“, sondern „Subtilität und Realismus“ sowie die „außenpolitische Selbstbeschränkung“ und „deideologisierte Sachlichkeit“12 sind heute mehr denn je gefragt.
(b) Menschenrechtspolitik versus Friedenspolitik
Die aktuelle weltpolitische Gemengelage ähnelt frappierend jener Zeit, in der Nixons Entspannungspolitik entstand und ausgebildet wurde. Zwei neue Entwicklungen fand die Nixon- Administration vor: (1) Trotz der bipolaren Weltordnung hat sich die Zahl der Mitspieler am internationalen System vervielfacht. (2) Die gegenseitige Beeinflussung hat sich infolge der Informationstechnologie stark verbessert.
Das internationale System wurde trotz militärischer Bipolarität politisch ,0,multipolarer und dadurch zunehmend instabiler. „Angesichts dieser Instabilitäten war es eine vorrangige Aufgabe, ein neues Konzept der internationalen Ordnung zu entwickeln . . . Die militärische Macht der Supermächte war, gerade weil sie so unkontrolliert und unvorstellbar zugenommen hatte, immer ungewisser geworden. Mehr militärische Macht verlieh nicht mehr Macht“, wodurch das „Gleichgewicht des Schreckens“ fragiler und die Stabilität der Weltordnung fragwürdiger geworden ist. „Das Konzept der militärischen Überlegenheit hatte . . . an Bedeutung verloren.“13
Das Spannungsverhältnis „zwischen der militärischen Bipolarität der Supermächte und der politischen Multipolarität“ zeigte sich für Kissinger insbesondere in Europa und in der NATO. „Das politische und wirtschaftliche Widererstarken Europas, während gleichzeitig die Supermächte ihre nuklearen Zerstörungskapazitäten immer weiter ausbauten, führte zu Spannungen innerhalb der Allianz, die mit militärischen Mitteln allein nicht zu überbrücken waren“. 14 Vor diesem Hintergrund und angesichts des fortdauernden Vietnamkrieges war für Kissinger eine Entspannungspolitik unausweichlich. Indem er das nationale Interesse der USA in einer stabilen internationalen Ordnung sah, plädierte er für eine Gleichgewichtspolitik, um eben diese Stabilität zu erreichen. Die USA konnten allein „ihre Politik den anderen Ländern nicht mehr aufzwingen, deshalb plädierte er für weniger globales Engagement der Vereinigten Staaten“ 15.
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Entspannungspolitik bedeutete Stabilitätspolitik, die Stabilitätspolitik bedeutete Friedenspolitik. Auf diesen vereinfachten Nenner könnte man die ganze „Nixon-Doktrin“ reduzieren. Internationales Chaos sei unvereinbar mit der Stabilität der internationalen Ordnung und darum friedensgefährdend. Die Gründung der United Nations (UNO) nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Wesentlichen von der Frage nach der Weltfriedenssicherung geleitet. Da es sich ziemlich schnell herausstellte, dass das de jure bestehende „System der kollektiven Sicherheit“ der neu geschaffenen Weltorganisation (UNO) infolge der Supermächterivalität gelähmt war, war man auf der Suche nach einer Außenpolitik, welche die Bedrohung des Weltfriedens zumindest de facto abwenden könnte. Alles hing dabei von Fragen nach der Natur der Friedensbedrohung ab und mit welchen Mitteln und Ressourcen man diese Bedrohung beizukommen bereit und in der Lage wäre.
Genau mit diesen Fragen wurde die amerikanische Außenpolitik auf dem Höhepunkt der great debate zwischen Dezember 1950 und April 1952 konfrontiert. Bei dieser Debatte ging es in erster Linie um eine „risikomindernde“ oder „kostenmindernde Strategie“ der Friedenssicherung.16 „Das Verhältnis zwischen strategischen Zielen und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit bzw. zwischen der Perzeption der Bedrohung und der Perzeption der Ressourcen bestimmte die Formulierung der grand strategy.17 Diese grand strategy wurde im Wesentlichen ideologisch bestimmt und hat sich vom universalen, auf dem „westlichen Wertekanon“ beruhenden Charakter der Weltordnungsprinzipien leiten lassen. Erst die 1970er-Jahre markieren mit Nixons Entspannungspolitik eine Abwendung von derideologischgeleitetenUS-Außenpolitik.„KissingernannteesdieRückkehrzurRealpolitik …,ohne dass sie die endgültige Abkehr von den Wilsonschen Ideale bedeutete. Tatsächlich hatte die Administration mit dem neuen Kurs jenen Mittelweg zwischen Konfrontation und Status quo-Denkenbeschritten.“18
Der von der Nixon-Administration eingeleitete Kurswechsel in der US-amerikanischen Außenpolitik markierte „den Beginn einer neuen Ära“, deren „hervorstechendes Merkmal“ war: (1) „größere Zurückhaltung in der Weltpolitik“, (2) die Politik des „praktisch Möglichen“ statt ideologisch motivierter Weltpolitik und schließlich (3) „klare Rangordnung der Prioritäten statt Weltordnungspolitik“.19 Die Außen- und Sicherheitspolitik der Nixon-Administration bedeutete letztlich „die radikale Abkehr von den konventionellen Strategieansätzen der Containment-Politik und einer über zwei Jahrzehnte lang primär ideologisch motivierten Weltpolitik bei gleichzeitiger Relativierung des Suprematiegedankens.“20 In der Nixon-Administration setzte sich die Erkenntnis durch, „dass Sicherheit auf einem vernünftigen globalen Kräftegleichgewicht beruhte, Weltpolitik also von Disharmonien geprägt war und von der Bereitschaft abhing, Kompromisse auszuhandeln“21.
Nixon/Kissingers Außenpolitik folgte de facto „einer an den Prinzipien der Realpolitik orientierten, globalen Gleichgewichtspolitik, die nicht auf ideologische Konfrontation setzt, sondern einen Interessenausgleich anstrebt. >Ideologische Rigidität und politischer Pragmatismus<, bei kaum einem Präsidenten zuvor fanden sich beide Grunddeterminanten amerikanischer Außenpolitik der Nachkriegszeit in so einzigartiger Weise kombiniert. Wären Watergate und der Selbstzerstörungsprozess des Präsidenten nicht gewesen, die Nixon-Revolution hätte womöglich die USA und die Welt noch tiefgreifender und nachhaltiger verändert.“22
Die Zentrierung der Entspannungspolitik um Stabilitäts- bzw. Friedenspolitik hat Kissinger allerdings die Kritik seiner Kontrahenten angebracht: Er schere sich nicht um die Menschenrechtspolitik. Kissinger sah seinerseits diese Kritik seiner Opponenten als unangebracht. „Er teilte nicht die Ansicht jener Kritiker seiner Politik, die in internen Veränderungen der Sowjetunion eine Vorbedingung jeglicher Entspannungspolitik sahen.“ Ausschlaggebend war für ihn allein das außenpolitische Handeln der Sowjets, wobei die Entspannungspolitik seiner Meinung nach auch „die besten Voraussetzungen für innenpolitische Veränderungen“ geschaffen habe.
„Genau an diesem Punkt aber hakten seine Kritiker ein. Aus ihrer Sicht hatte die Unterdrückung der sowjetischen Dissidenten mit Einsetzen der Entspannungspolitik begonnen.“ Auch die Appelle der Dissidenten, das Sowjetregime zu innenpolitischen Zugeständnissen zu zwingen, sahen die Gegner der Entspannungspolitik als Bestätigung ihrer Kritik an.
Kissinger reagierte auf die Kritik mit dem Argument, dass „die Erhaltung des Friedens oberstes Gebot sei“ und man „den Frieden – oder die Entspannungspolitik (eine Gleichsetzung, die von den Kritikern nicht unbedingt akzeptiert wurde) – nicht wegen untergeordneter moralischer Prinzipien gefährden (dürfte)“23.
Die Entspannungspolitik war – wie man sieht – eine direkte Folge der Priorisierung der Stabilitätspolitik als Friedenspolitik vor allen anderen ideologischen und moralischen Erwägungen, auch wenn die Sowjetführung selbst im Verlauf der insbesondere ein Handelsabkommen betreffenden Verhandlungen letztendlich Zugeständnisse in der Innenpolitik machte. Diese sich allein an der Stabilitätspolitik orientierte, aus der Not geborene Entspannungspolitik der Nixon-Administration war – langfristig gesehen – nicht tragfähig und jederzeit gefährdet, da sie vor dem Hintergrund eines scharfen ordnungspolitischen, axiologischen und ideologischen Antagonismus der Supermächte unter nuklearstrategischen Bedingungen der beiderseitigen gesicherten Vernichtungsfähigkeit stattfand. In dieser Entspannungspolitik war bereits ein die Stabilität und die Kooperationsbereitschaft ignorierender ideologischer Sprengstoff gelegt, den die Reagan-Administration in den 1980er-Jahren zur Explosion brachte, die ihrerseits die ganze Entspannungspolitik letztlich unter sich begrub. Die „Nixon-Doktrin“ erweist sich zwar für die Gegenwart eher als Fata Morgana denn als Blaupause. Die ihr zugrundeliegenden Intentionen bleiben aber dessen ungeachtet aktueller denn je.
3. Neues Machtgleichgewicht oder das alte Hegemoniestreben?
(a) Im Widerstreit zwischen Wahrscheinlichem und Wünschbarem
Die Weltordnung der Gegenwart befindet sich am Scheideweg zwischen Krieg und Frieden, Geopolitik und Geoökonomie, Machtgleichgewicht (balance of power) und Hegemoniestreben, dem System der kollektiven Sicherheit (UNO) und Blockbildungen, Kooperation und Konfrontation, Integration und Desintegration, kurzum: zwischen Wahrscheinlichem und Wünschbarem.
„Leider sieht es so aus“ – entrüstete sich John H. Herz sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1951) -, „als ob jeweils dem, was am wahrscheinlichsten ist, das am wenigsten Wünschenswerte entspricht und umgekehrt.“24 Und am Schluss seines kurz gefassten Aufsatzes fragt er nachdenklich: „Welches sind die Möglichkeiten friedlichen Ausgleichs in einem dualistischen System? Ist ein solcher überhaupt möglich, wenn zum Dualismus der Macht noch der Gegensatz der Ideologien und Regime hinzutritt? . . . Von der Lösung solcher Probleme wird es abhängen, ob sich Machtpolarität und Frieden vereinigen lassen . . . Der Optimist mag entgegnen, dass die Geschichte keine absoluten Gesetzlichkeiten vorschreibt, dass es vielmehr möglich ist zu unterscheiden zwischen dem, was utopisch ist, und dem, was als Ideal realisierbar ist und damit Aufgabe und Ziel der Staatskunst werden kann.“25
Welche „Staatskunst“ müssen wir heute praktizieren, um die Großmächterivalität und Weltfrieden in Anbetracht des ideologisch und axiologisch erbittert geführten Informationskrieges in Einklang bringen zu können? Es stellen sich die Fragen nach einer wahrscheinlichen Weltordnung der Zukunft und einer wünschbaren modernen Außenpolitik zwecks Erzielung einer friedlichen Koexistenz der rivalisierenden Groß- und Weltmächte. Hat die Zukunft (noch) eine Zukunft für einen Weltfrieden oder ist das schon zu spät?
Alle in der Geschichte bekannten Machtkonstellationen sind bis jetzt gescheitert. Das „klassische“ europäische Machtgleichgewicht besagte, dass der Frieden nur erhalten werden kann, wenn ein Gleichgewicht zwischen den Großmächten besteht und keine Großmacht die Vorherrschaft besitzt, um die anderen Großmächte zu dominieren. In diesem Gleichgewichtssystem herrschte zwar Konfrontation, aber „diese Konfrontation wird gezügelt durch den gemeinsamen Willen zur Erhaltung des Gleichgewichts, der die Bereitschaft zum Krieg einschließt, wenn die Wiederherstellung des Gleichgewichts es erfordert“26. Das Jahrhundert zwischen 1815 und 1914 ist als das Jahrhundert des europäischen Gleichgewichts – das sog. „Europäische Konzert“ – in die Geschichte eingegangen. 1914 brach es zusammen, da es schon „seit etwa 1890 durch Imperialismus, Wettrüsten und übersteigenden Nationalismus zunehmender Erosion ausgesetzt gewesen war. Erfolg und Misserfolg lagen in diesem„Europäischen Konzert“ der Großmächte „nahe beieinander. Stabilität folgte früher oder später der Zusammenbruch, und der Zusammenbruch führte zu umfassenden Groß-Kriegen . . . Hegemoniestreben war eine wesentliche Ursache für Störungen der Gleichgewichtspolitik, führte aber niemals zu ihrem Zusammenbruch. In einem funktionierenden Gleichgewichtssystem handelten die status-quo-Mächte in ihrem eigenen Interesse, wenn sie sich gegen eine nach Vorherrschaft strebende Macht verbündeten.“27
Die Schwächen dieses Gleichgewichtssystems führte am Ende des Ersten Weltkriegs zum Versuch der Bildung eines neuen Machtsystems, dem System der kollektiven Sicherheit. Auch dieses Experiment scheiterte bekanntlich. Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ließen sich erneut von der Idee der kollektiven Sicherheit beim Aufbau der Nachkriegsordnung inspirieren. „Im Gegensatz zur Politik der balance of power, die einen Machtausgleich durch Stärkung der nationalstaatlichen Souveränität bei gleichzeitiger Zurückdrängung expansiven Hegemoniestrebens anstrebte und so den Frieden zu erhalten suchte“, beruhte die Idee der kollektiven Sicherheit auf der Annahme, nur durch einen Abbau der Konfrontation und durch alle Staaten einschließende gemeinsame Sicherheitsgarantien auf der Basis des status quo sei dauerhafte Friedenssicherung möglich28.
Auch diese Annahme erwies sich als Illusion angesichts der entstandenen bipolaren Weltordnung. Die „List der Idee“ wollte es – bedauerte John Herz29 -, „dass die Niederlage der Angreifer-Staaten nicht zu dem führte, was man erhoffte . . ., sondern zu einer Machtsituation, die nie zuvor im modernen Staatensystem bestanden hatte: der Polarisierung der Macht. Die Tatsache der Machtkonzentration in zwei und nur zwei Weltzentren, in zwei superpowers, ist das, womit jeglicher Versuch einer neuen Machtregulierung zu rechnen hat. Das bedeutet zunächst die Einsicht, dass die reale Basis für das >klassische< Gleichgewichtssystem wie auch für das System der Kollektivsicherheit geschwunden ist . . . Was bleibt, ist ein Gleichgewicht, das nicht mehr System sein kann: zu starr, um die Ausgleichsmöglichkeiten zu haben . . ., zu prekär, um Dauer zu versprechen . . . Man mag es die Tragik der Idee der kollektiven Sicherheit nennen . . . Die Schöpfer der United Nations waren realistisch genug dies zu sehen. Roosevelt, Stalin und Churchill gründeten die Vereinten Nationen auf Idee und Hoffnung friedlicher Zusammenarbeit und friedlichen Kompromisses der superpowers. Organisatorisch entsprach dem das Vetorecht der Mächte im Sicherheitsrat. Dies legalisierte ein System der Mächte-Oligarchie, welches der faktischen Machtpolarisierung entsprach.“
Der de facto bestehende Antagonismus zwischen den Supermächten hat das de jure institutionalisierte „System der kollektiven Sicherheit“ ausgehöhlt. Nixons Entspannungspolitik der 1970er-Jahre war der einzige Versuch während des Kalten Krieges, die Idee der kollektiven Sicherheit zu reanimieren. Die Entspannungspolitik suchte, „den Spannungsgrad des Ost-West-Konflikts zu reduzieren und auf der Basis des status quo zu einer Zusammenarbeit zu gelangen, in der dem militärischen Faktor eine zunehmend geringere Bedeutung zukommen und die militärische Konkurrenz schrittweise durch andere, friedlichere Formen des Wettbewerbs ersetzt werden soll“30.
Dieses Ziel, dem „militärischen Faktor“ eine geringere Bedeutung zukommen zu lassen, wurde erst heutzutage einerseits weitgehend erreicht, andererseits verfehlt. Im Bereich des zunehmend erbittert geführten Informationskrieges zwischen Russland und China einerseits und dem kollektiven Westen andererseits haben die militärischen Drohgebärden eher zugenommen als abgenommen haben, wohingegen der „militärische Faktor“ in der geopolitischen Konfrontation dramatisch an Bedeutung verloren hat. Im Gegensatz zum Kalten Krieg erwuchs stattdessen ein neuer, geoökonomischer (inclusive monetärer) Faktor, da die Wirtschaftssysteme der geopolitischen Rivalen nicht mehr voneinander isoliert bestehen, sondern ganz im Gegenteil wechselseitig verflochten und verschmolzen sind. Der geoökonomische Faktor ist vor dem Hintergrund eines ideologisch gehässig geführten Propagandakrieges zum eigentlichen geopolitischen Zankapfel der Großmächterivalität geworden.
Das Hauptproblem der gegenwärtigen Weltordnung bleibt allerdings nach wie vor der unüberbrückbare Antagonismus zwischen dem westlichen Hegemoniestreben unter der Führung des US-Hegemons und dem Gleichgewichtsstreben der Großmächte Russland und China. Von diesem Widerstreit der rivalisierenden Machtinteressen hängt die Zukunft der Weltordnung und des Weltfriedens ebenso, wie die zukünftige Ausrichtung der US-amerikanischen Außenpolitik ab.
Alle bis heute bekannten Gleichgewichtssysteme: das europäische Gleichgewicht des 18./19. Jahrhunderts, das de jure bestehende System der kollektiven Sicherheit des Völkerbundes und der UNO sowie das auf Grundlage der „Mächte-Oligarchie“ de facto vorherrschende „Gleichgewicht des Schreckens“ der bipolaren Weltordnung des 20. Jahrhunderts sind entweder gescheitert oder haben ausgedient. Die aktuelle, sich seit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums allmählich ausgebildete US-amerikanische Hegemonialordnung befindet sich momentan ebenfalls in einem Erosionsprozess. Der US-Hegemon hat sich schlicht und einfach militärisch und ökonomisch übernommen.
Auch das regionale, auf Kooperation und Integration beruhende Gleichgewichtssystem der Europäischen Union wankt und hat schon einmal bessere Zeiten gesehen. Gegenüber der Außenwelt tritt die EU als ein kooperatives und integrierendes Gleichgewichtssystem mit Ambitionen zumindest auf eine regionale „Kollektivhegemonie“ (Werner Link) auf, was zwangsläufig die Gegenwehr der nicht kooperationswilligen und integrationsfähigen Mächte hervorruft und zu einer Gegenmachtbildung provoziert. Die als Kollektivhegemon auftretende EU hat geopolitisch keine reale Machtsubstanz, da sie von dem bei weitem mächtigeren, den globalen Raum dominierenden US-Hegemon jederzeit zur Ordnung gerufen werden kann. Sie steht zudem der Russländischen Föderation als einer Gegenmacht gegenüber, der sie geopolitisch nicht ohne Weiteres gewachsen ist, von der Existenz einer geoökonomischen Supermacht China ganz zu schweigen.
Das von der EU geschaffene Integrationselement im Gleichgewichtsystem ist ein prekäres Konstrukt und kann sich bestenfalls auf regionaler Ebene – wenn überhaupt – seine Geltung verschaffen. Global kann ein solches auf Kooperation und Integration beruhendes Gleichgewichtskonstrukt gar nicht funktionieren. „Gemeinschaftsbildung statt Gegenmachtbildung, gegenseitige Kontrolle und Beschränkung in einer gemeinsamen Institution statt Kontrolle von außen mittels Allianzen“31 kann idealtypisch nur in einem solchen Machtumfeld bestehen, in dem eine ideologische, kulturelle und verfassungsrechtliche Homogenität der Staatenwelt besteht. Diese Staatenwelt gibt es aber vielleicht nur noch im Paradies.
Das integrative EU-Gleichgewichtssystem setzt zudem genauso, wie zu Zeiten des „Europäischen Konzerts“, einen (US-)Hegemon voraus, der „die Sicherheit der nicht-nuklearen europäischen Staaten“32 garantiert. Das europäische Gleichgewichtssystem des 19. Jahrhunderts war im Grunde ebenfalls „eine Hegemonialordnung, definiert aus dem Interesse der britischen See- und Handelsmacht“. Es ging hier letztlich „um Sicherheit durch Gleichgewicht und stillschweigende englische Hegemonie“. „Wenn das ein Widerspruch war – Gleichgewicht zu Lande, Hegemonie zu See -, so lag darin doch die Voraussetzung der europäischen Stabilität“33. Das EU-Machtgleichgewicht ist folglich für den globalen Raum weder tragfähig noch lebensfähig.
Alle bisher bekannten Gleichgewichtssysteme sind unfähig, die in den vergangenen zwanzig Jahren destabilisierte Weltordnung zu stabilisieren. Was nun? Soll etwa ein neuartiges Balancesystem geschaffen werden, um die Weltordnung wie zurzeit von Nixons Entspannungspolitik stabilisieren zu versuchen? Oder bleibt es alles beim Alten und der US-Hegemon dominiert auf immer und ewig? Dagegen spricht allerdings die sich im Erosionsprozess befindende US-Weltdominanz!
Damit werden wir erneut mit der Frage nach dem Wahrscheinlichen und Wünschbaren konfrontiert und auf den Widerstreit der rivalisierenden Machtinteressen von Hegemonie und Gleichgewicht zurückgeworfen. In Anbetracht der neu strukturierten globalen “Mächte-Oligarchie“ stellen sich erneut Fragen zum alten Grundproblem von Gleichgewicht und Hegemonie.
(b) Globale Gleichgewichtspolitik als Entspannungspolitik
In den Jahren 1989-1991 verloren die Sowjetunion und China ihre Bedeutung in Henry Kissingers „großem strategischen Dreieck“, weil das „Dreieck“ mangels der Teilnehmer aufhörte zu existieren. Der einzig übrig gebliebene Teilnehmer ist zum Welthegemon aufgestiegen. Dreißig Jahre sind vergangen und man stellt erstaunt eine Auferstehung des „großen strategischen Dreiecks“ wie ein Phönix aus der Asche fest. Es ist heute eine geopolitische Realität, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Im Vordergrund steht nicht mehr eine ideologische und geopolitische Blockkonfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion, sondern eine verbissene geoökonomische und technologische Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Die zwei geoökonomischen Supermächte und eine geopolitische Großmacht stehen erneut im Zentrum der geopolitischen Rivalität, wobei der alle und alles überragende US-Hegemon die Schlüsselrolle in diesem gigantischen geopolitisch inszenierten Theaterstück spielt, Russland hingegen am Rande des Dreiecks steht.
Der Kampf um den globalen Raum befindet sich heute womöglich im Endstadium der Weltgeschichte. Wer obsiegt, bleibt ungewiss. Die vergangenen dreißig Jahre haben den Erosionsprozess der bestehenden Nachkriegsordnung vor dem Hintergrund des „glorreichen“ Sieges des Westens über den ideologischen Feind im Kalten Krieg beschleunigt und ein derart dramatisches Ausmaß angenommen, dass nicht nur die vom Westen dominierte Weltordnung, sondern auch die jahrhundertelange Weltherrschaft der westlichen Hemisphäre zur Disposition steht. Die sich im Umbruch befindende Weltordnung hat tiefe Spuren bei den Welt- und Großmächten hinterlassen:
Russland hat sich zwar nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems geopolitisch weitgehend konsolidiert; es befindet sich aber nach wie vor in einer geoökonomischen Sackgasse34.
Europa ist zu einer geopolitischen Provinz verkommen. Seit dem Ende des Kalten Krieges befindet es sich in einer relativen Abwärtsspirale von globalem Machtverlust, geoökonomischem Machtschwund und technologischem Rückstand bei gleichzeitig stattfindenden innereuropäischen und innerwestlichen Machtkämpfen bezüglich monetärer, außenwirtschaftlicher und außenpolitischer Angelegenheiten.
Die USA befindet sich im Spannungsverhältnis zwischen der Aufrechterhaltung ihrer geopolitischen Vormachtstellung, einem relativen geoökonomischen Machtverlust, der außenpolitischen Dysfunktionalität des politischen Systems und einer innerwestlichen handelspolitischen Rivalität.
China befindet sich in einer Zwickmühle. Sein Aufstieg zur geoökonomischen Supermacht bei einem gleichzeitigen innenpolitischen Modernisierungsrückstand provoziert eine geoökonomische, technologische und zunehmend ideologische Rivalität seitens des US-Hegemons, der wohl zu Recht seine geopolitische Weltdominanz als bedroht und gefährdet ansieht.
Die Folge all dieser tektonischen Machtverschiebungen im globalen Raum sind Deglobalisierungstendenzen in der (noch) globalisierten Weltwirtschaft und ein Desinformationskrieg in beinahe allen Politik- und Lebensbereichen. Im Bestreben, tatsächliche oder vermeintliche geopolitische Rivalen auszuschalten, schlägt der „omnipotente“ US-Hegemon bestrafend, eskalierend und sanktionierend um sich ohne Rücksicht auf Verluste.
Der Umstand, dass heute der Weltfrieden und die ihn bedingende globale Stabilität nicht so sehr von der „strategischen Stabilität“ oder von weltweit bestehenden liberal-demokratischen Institutionen als vielmehr von einer gegenseitigen geoökonomischen und ideologischen Deeskalation abhängt, wird auf unterschiedliche Art und Weise sowohl von Russland und China als auch von den USA mit deren Verbündeten negiert. Dieses disparate innere und äußere Stabilitätsverständnis führt dazu, dass die Kontrahenten mit ihren beiderseitigen Drohgebärden sich gegenseitig neutralisieren, was auch ihre jeweilige Abschreckungsstrategie wirkungslos macht. Deswegen missversteht der Westen die russische Nuklearstrategie als „Eskalation zur Deeskalation“, wohingegen Russland nicht begreifen kann oder will, warum es als „nukleare Supermacht“ nicht ernstgenommen wird.
An einer globalen Stabilität hatte die bisherige US-Außenpolitik auch gar kein Interesse, sehr wohl aber an einer strategischen Destabilität. Der US-Hegemon war eher an Chaos als Ordnung, eher an Krieg als Frieden, eher an Elend als Wohlstand außerhalb seines Staatsgebietes interessiert, um im Trüben zu fischen und als ein großer Fisch kleinere Fische fressen zu können. Auch deswegen schenkten die USA der „strategischen Stabilität“ wenig bis gar keine Beachtung, zumal sie grundsätzlich von einem defensiven Charakter der russischen Nuklearstrategie ausgehen. Im Gefühl der eigenen militärischen, ökonomischen und moralischen Überlegenheit dachten sie bisher im Traum nicht daran, auf ihre Eskalationsdominanz verzichten zu wollen. Ob das so bleiben wird, ist indes mehr als fraglich.
Das Bemerkenswerte an der US-amerikanische Welthegemonie der vergangenen dreißig Jahre war ihre scheinbar „grenzenlose“ militärische und monetäre Unterfütterung. Diese vermeintliche Grenzenlosigkeit stößt jedoch erst dann an ihre natürlichen Grenzen, wenn sie sich selbst erschöpft, was gegenwärtig auch der Fall zu sein scheint. Das Schicksal der Sowjetunion sollte dabei auch für den US-Hegemon als Warnung dienen, seine „Omnipotenz“ nicht zu überschätzen.
Vor dem Hintergrund der skizzierten geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Und vor allem: Welche Machtkonstellationen finden wir heutzutage vor, welche die USA womöglich zu einer anderen zeitgemäßen Außenpolitik bewegen könnten? Momentan herrschen zwei unterschiedlich starke globale Triaden, die mit-, gegen- oder nebeneinander bestehen und handeln:
(1) Eine mächtige geopolitische Triade („das große strategische Dreieck“), die aus den USA, Russland und China besteht.
(2) Eine mächtige geoökonomische Triade, die aus den USA, China und der EU besteht.
In den beiden globalen Triaden sind gleichzeitig nur zwei Machtzentren vertreten: die USA und China, was eine herausragende globale Bedeutung der beiden nur noch unterstreicht, wohingegen Russland und die EU in jeweils der anderen Triaden fehlen. Dieses doppelte, mit unterschiedlichem Machtgewicht ausgestattete Triaden-Geflecht entscheidet über die Zukunft des globalen Raumes und nicht zuletzt über das Fortbestehen des „amerikanischen Jahrhunderts“ womöglich bereits in dem kommenden Jahrzehnt.35
Die Frage aller Fragen ist: Wie will man eigentlich in einer Welt, bestimmt von Anarchie und Gewalt, Großmächterivalität und rabiater Machtpolitik, Hegemonie- und Gleichgewichtstreben, politischen und ökonomischen Ungleichgewichten gleichzeitig Aggression schüren und Spannungen abbauen, die eigenen nationalen Interessen durchsetzen und zugleich die universellen Werte missionieren, den Frieden predigen und den Krieg führen? Wie sollte man diese globale „structure of peace“ der Zukunftvorstellen? Geht man von dem Wünschbaren (und nicht Wahrscheinlichen) aus, so müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:
(1) die Akzeptanz der unterschiedlichen Verfassungsordnungen als Vorbedingung der friedlichen Koexistenz der Großmächte (realpolitisches Gleichgewicht).
(2) die Überwindung des westlichen und insbesondere US-amerikanischen Anspruchs, die Weltordnung nach eigenen Wertvorstellungen gestalten zu wollen (axiologisches Gleichgewicht).
(3) Die Einsicht in die Grenzen der eigenen ökonomischen und monetären Möglichkeiten als Grundvoraussetzung des Kräftegleichgewichts (geoökonomisches Gleichgewicht).
Die drei wünschbaren Voraussetzungen für eine Friedensordnung der Zukunft stehen im krassen Gegensatz zu den geopolitischen und geoökonomischen Gegebenheiten der Gegenwart. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass die USA ihre Außenpolitik vor dem Hintergrund des Machtwechsels von der Trump- zur Biden-Administration und der – geostrategisch gesehen – absolut richtigen Entscheidung, sich aus Afghanistan zurückzuziehen, dahingehend revidieren wird, dass sie eine aus der Not geborene Selbsteindämmung (self-contaiment) praktizieren wird.
Die Biden-Administration kann dabei von Nixon/Kissingers Entspannungspolitik viel lernen. Für die Nixon-Administration ging es in erster Linie darum, „das legitime Sicherheitsbedürfnis Moskaus zwar anzuerkennen, der sowjetischen Führung gleichzeitig aber klar zu machen, dass im wohlverstandenen Eigeninteresse liege, ihre politischen Zielvorstellungen im Rahmen einer stabileren, multipolaren Weltordnung zu definieren. Mit anderen Worten, Washington war bereit, der Sowjetunion im nuklearstrategischen Bereich die . . . Parität einzuräumen . . . Von politischer Parität aber war keine Rede. Die Nixon-Administration betrachtete es unverändert als ihr Ziel, den Status quo der Macht- und Einflussverteilung zu bewahren.“36 Dieser Zielsetzung lag die Vorstellung vom stabilen Gleichgewicht auf dem europäischen Kontinent zugrunde, der „nur durch die amerikanische militärische Präsenz zu gewährleistet“ wäre. Kissinger ging davon aus, dass „politische Überlegenheit oder der Erhalt eines politischen Kräftegleichgewichts nicht nur eine Frage von Macht war, sondern auch von der Struktur des Umfeldes, innerhalb dessen diese ausgeübt wurde“, wobei „der Fokus der Kissingerschen Geopolitik auf dem militärischen Equilibrium (lag)“37.
Geopolitik und Machtgleichgewicht waren für Kissinger „quasi synonyme Begriffe – oder besser gesagt, sie bildeten praktisch eine Begriffseinheit“38. Geopolitik sei nach Kissinger Gleichgewichtspolitik und in diesem Sinne auch Entspannungspolitik. Heute geht es aber nicht so sehr um ein „militärisches“ als vielmehr um ein globales Equilibrium. Eine andere Außenpolitik ist heute im Sinne der Entspannungspolitik eine globale Gleichgewichtspolitik. Ob sie wahrscheinlich sein wird, hängt auch von der Macht des Faktischen ab.
Anmerkungen
- Koch, M., Europas Anti-China-Strategie. Brüssel setzt auf Allianzen mit gleichgesinnten Staaten, um dem Machtstreben Pekings entgegenzuwirken, in: Handelsblatt vom 14.09.21, S. 12.
- Aron, R., Auf der Suche nach einer Doktrin der Außenpolitik (1953), in: des., Zwischen Macht und Ideologie. Politische Kräfte der Gegenwart. Wien 1972, 285-305 (286).
- Chomsky, N., The New Military Humanism. Lessons from Kosovo. London 1999.
- Aron (wie Anm. 2), 286.
- Junker, D., Power and Mission. Was Amerika antreibt. Freiburg 2003, 9.
- Kissinger, H., Die Vernunft der Nationen. Über das Wesen der Außenpolitik. Berlin 1994, 782.
- Kissinger (wie Anm. 6), 784.
- Kissinger (wie Anm. 6), 784, 788.
- Junker (wie Anm. 5), 108.
- vgl. Nixons „Neue Friedensstrategie“, in: Europa-Archiv 25 (1970), 145-174.
- Stürmer, M., Vernunft des nuklearen Friedens scheint vergessen, 16.09.2014.
- Hacke, Ch., Die Ära Nixon-Kissinger 1969-1974, 16 f., 24, 42, 123.
- Schweigler, G., Von Kissinger zu Carter. Entspannung im Widerstreit von Innen- und Außenpolitik1969-1981. München Wien 1982, 25.
- Schweigler (wie Anm. 13), 26.
- Ebd., 27.
- Näheres dazu Fröhlich, S., Zwischen selektiver Verteidigung und globaler Eindämmung.Geostrategisches Denken in der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik während desKalten Krieges. Baden-Baden 1998, 239 f.
- Fröhlich (wie Anm. 16), 240.
- Ebd., 387.
- Ebd., 388.
- Ebd., 391.
- Ebd., 396.
- Ebd., 391 f.
- Schweigler (wie Anm. 13), 196 f.
- Herz, J. H., Macht, Mächtegleichgewicht, Machtorganisation im Atomzeitalter (1951), in:Staatenwelt und Weltpolitik. Aufsätze zur internationalen Politik im Nuklearzeitalter. Hamburg 1974, 57-61 (60).
- Herz (wie Anm. 24), 61.
- Görtemaker, M., Die unheilige Allianz. Die Geschichte der Entspannungspolitik 1943-1979.München 1979, 13.
- Ebd., 14 f.
- Ebd., 15.
- Herz (wie Anm. 24), 58 f.
- Görtemäker (wie Anm. 26), 13.
- Link, W., Die europäische Neuordnung und das Machtgleichgewicht, in: Jäger, Th./Piepenschneider, M. (Hrsg.), Europa 2020. Szenarien politischer Entwicklungen.Opladen 1997, 9-31 (12).
- Link (wie 31), 27.
- Stürmer, M., Die Kunst des Gleichgewichts. Europa in einer Welt ohne Mitte. München 2001, 27, 40.
- Näheres dazu Silnizki, M., Geoökonomie der Transformation in Russland. Gajdar und die Folgen. Berlin 2020, 106 ff.
- Näheres dazu Silnizki, M., Anti-Moderne. US-Welthegemonie auf Abwegen. Berlin 2021, 94 ff.
- Fröhlich (wie Anm. 16), 413.
- Ebd., 440.
- Ebd., 456.