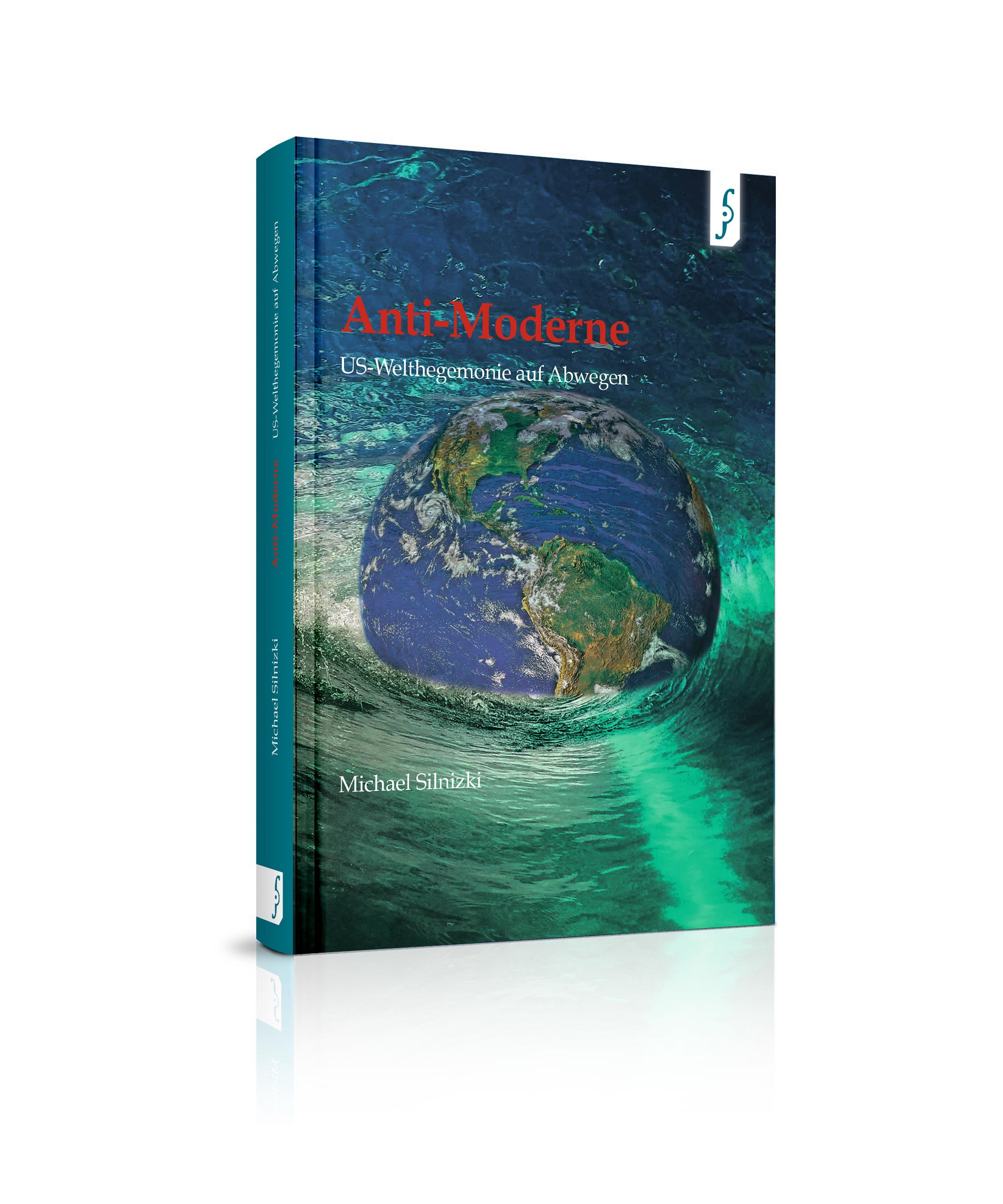Auf dem Weg zu einer neuen Sicherheitspolitik in Europa?
Zur Diskussion
Übersicht
1. „Das letzte Gefecht“?
2. Sicherheitspolitik als Weltordnungspolitik?
3. Machtstaatspolitik als Sicherheitspolitik?
Anmerkungen
An Stelle einer „Weltmacht ohne Gegner“1 ist längst das
letzte Machtgefecht gegen viele Gegner getreten.
1. „Das letzte Gefecht“?
„Kalte Kriegsmanie im Weißen Haus“. Unter diesem Titel veröffentlichte George W. Ball (1909-1994) seinen Artikel im Juli 1981 in der „Washington Post“. Ball war unter Kennedy und Johnson Staatssekretär im Außenministerium. Er schied 1966 aus dem Staatsdienst aus, weil er die Eskalation des Vietnam-Kriegs nicht mitverantworten wollte.
In seinem Artikel beklagt er eine auf Konfrontation angelegte US-amerikanische Sowjetpolitik, die mit der neuen US-Administration unter Ronald Reagan in den Machtkorridoren des Weißen Hauses Einzug gefunden hat.
Das Weiße Haus wende sich – so der empörte Vorwurf an die Adresse der Reagan-Administration – von der Entspannungspolitik der 1970er-Jahre ab und kehre zur Konfrontation der 1950er- und 1960er-Jahre zurück. Die Sowjetunion sei – höre man schon wieder – der Antichrist und bedrohe „die Zivilisation mit einer verderblichen Lehre“. Sie sei – behaupten Reagan und der US-Außenminister Alexander M. Haig Jr. – „verantwortlich für alle unsere internationalen Probleme … überall in der Welt … Entspannung ist Betrug. Gespräche über die strategische Waffenbeschränkung (Salt) sind eine Falle für den Unbedachten. Unsere einzige Hoffnung liegt in der MX-Atomrakete und in der Mobilisierung unserer Verbündeten für das letzte Gefecht.“2
Das „letzte Gefecht“ haben die Reagan- und die Bush-Administration erfolgreich ausgetragen. Die Sowjetunion ist klang- und geräuschlos untergegangen. Nach einem gut dreißigjährigen Bestehen der sog. „unipolaren Weltordnung“ unter Führung des US-Hegemonen träumen wir erneut vom „letzten Gefecht“ diesmal nicht gegen die Sowjetunion, sondern gegen deren Nachfolgestaat Russland.
Russland hat heute erneut die Ehre zum Feind des Westens auserkoren zu sein und „natürlich“ für alle innen-, außen- und sicherheitspolitischen Probleme in Europa verantwortlich gemacht zu werden. Getreu dem Schlachtruf: „Wehret den Anfängen“ ließen wir uns in einen Krieg hineinziehen, der nicht unserer ist und uns gar nichts angeht, weil er nicht gegen uns gerichtet ist, weil er eine innerostslawische Angelegenheit ist, weil er ein Bürgerkrieg ist, in dem wir nichts zu suchen haben, nichts gewinnen, aber alles verlieren können.
Und jetzt stecken wir im ukrainischen Kriegsschlamassel, aus dem wir nicht ohne Gesichtsverlust herauskommen werden. Im Glauben, schon wieder das „letzte Gefecht“ austragen zu müssen, zittern wir erneut „in den eisigen Winden des Kalten Krieges“ (Ball).
Der „Kalte Krieg“, der nach dem Ende des Ost-West-Konflikts eine lange Zeit in der Dunkelheit der Nacht verborgen blieb und nur für die Eingeweihten noch ein Begriff war, erwachte zum neuen Leben und wartete nur auf seine Chance, um mit voller Tatkraft auf die Weltbühne der Geschichte zurückzukehren.
Diese Chance ist mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine gekommen. Und jetzt ist der „Kalte Krieg“ in seinem Element. Jetzt zeigt er seine zwar verfaulten, aber immer noch scharfen Zähne, und ist im Begriff, alles wegzubeißen, was ihm im Wege steht.
Und so bläst uns dessen „eisiger Wind“ wieder stark ins Gesicht. Und wenn wir nicht aufpassen, kann dieser „eisige Wind“ sehr schnell in einen Chamsin – einen sehr unangenehmen heißen Wüstenwind – umschlagen.
Ja, der „Kalte Krieg“ ist nicht mehr das, was er mal war. Er muss nicht „kalt“ bleiben und kann heiß, sogar sehr heiß werden, wie der Krieg in der Ukraine auch zeigt. Denn heute haben wir ja keine Angst vor einer Konfrontation der Groß- und Weltmächte. Selbst eine nukleare Bedrohung schreckt uns nicht mehr ab. Die sog. „Klimakatstrophe“ wirkt auf uns beispielsweise viel beängstigender und bedrohlicher als „irgendeine“ nukleare Konfrontation.
Und so bewahrheitet sich erneut und immer wieder die Voraussage von Reagans Außenministers, Alexander M. Haig, der einst für Leonid Brežnevs Gesundheit betete, weil er glaubte, dass das nächste Gespann sowjetischer Führer aus Männern bestehen würde, „die einen Krieg nie kennengelernt haben und für die Stalingrad ein Filmtitel ist“.3
Die neue Generation weiß heute vermutlich nicht einmal, was Stalingrad überhaupt ist. Sie blickt heute derart selbstsicher und furchtlos in die Zukunft, dass sie sich lieber in ideologischen Scheingefechten verstrickt, und die Außenpolitik – die Diplomatie verneinend und axiologisch verklärend – durch anmaßende Belehrungen und PR-Gags substituiert.
Eine solche anmaßende und moralisierende westliche Außenpolitik führt nicht etwa zur Isolation Russlands, sondern ganz im Gegenteil zur Selbstisolation des Westens und eine zunehmende Entfremdung vom Rest der Welt. Der Westen und allen voran die USA sind geradezu versessen darauf, Russland im Ukrainekonflikt eine Lehre zu erteilen, sprich: eine sog. „strategische Niederlage“ zuzufügen, und kommt dabei nicht umhin festzustellen, dass diese Aufgabe ihnen eine Nummer zu groß ist.
Und so strampelt sich der Westen mit seinem Sanktionskrieg und seiner militärischen Unterstützung der Ukraine unbeholfen im Glauben ab – blindwütig um sich herumschlagend – ihr „letztes Gefecht“ doch noch erfolgreich auszutragen, obwohl Moskau längst militärisch in die Offensive übergegangen ist, sich ökonomisch konsolidiert hat und selbst diplomatisch immer selbstbewusster und erfolgreich auftritt.
Der Westen gerät dabei immer mehr in eine militärische, ökonomische und diplomatische Defensive und versinkt immer tiefer im Sumpf des Ukrainekonflikts. Und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Alle einst erfolgreichen, funktionierenden Druckmittel werden stumpf und wirkungslos, und zwar nicht einmal deswegen, weil der Westen schwächer geworden ist, sondern weil der Rest der Welt stark aufholt und in seinem Auftreten immer selbstbewusster wird.
Aber genau diese unaufhaltsame, nicht mehr zu bremsende Emanzipation des Nichtwestens will der Westen weder wahrhaben noch akzeptieren oder tolerieren. Noch besteht die Chance der Umkehr, noch haben wir die Welt nicht in die Luft gesprengt, noch ist die Eskalation nicht außer Kontrolle geraten, noch kann man das „letzte Gefecht“ auf sich ruhen lassen.
Die Uhr tickt und keine(r) weiß: Wie lange noch? Oder wissen doch einige vielleicht mehr als die anderen und erklären die tickende Bombe mit dem dysfunktionalen Charakter der bestehenden, von den USA dominierten Sicherheitspolitik in Europa?
2. Sicherheitspolitik als Weltordnungspolitik?
Der Vordenker der heute geltenden US-Geo- und Sicherheitspolitik in Europa war ausgerechnet der unbeliebte 39. US-Präsident, Jimmy Carter (1977-1981), der seine sicherheitspolitischen Vorstellungen bereits 1976 in einer griffigen Formel zusammenfasste: „Wir müssen die Politik des Gleichgewichts der Kräfte durch eine Weltordnungspolitik ersetzen.“
„In naher Zukunft werden sich die Fragen von Krieg und Frieden eher aus wirtschaftlichen und sozialen Problemen ergeben als aus der militärischen Sicherheit, die die internationalen Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg beherrscht hat“, zeigte sich Carter überzeugt.4
Carters Zukunftsvision von einer Sicherheitspolitik als Weltordnungspolitik, die an die Stelle der Gleichgewichtspolitik treten sollte, ist nach dem Ende der bipolaren Weltordnung tatsächlich in Erfüllung gegangen. An Stelle des „Gleichgewichts des Schreckens“ trat eine US-Weltordnungspolitik, die eine „unipolare Weltordnung“ unter der US-Führung aus sich hervorbrachte.
Dass die Fragen von Krieg und Frieden eher wirtschafts- und sozialpolitisch denn militärisch entschieden werden sollten, blieb freilich bis dato ein Wunschdenken. Seit dem Ende des „Kalten Krieges“ erlebten die USA eine exzessive Militarisierung ihrer auf Expansion und die globale Führerschaft ausgerichteten Außenpolitik mit verheerenden Folgen für den Weltfrieden.
Die von Jimmy Carter vorgedachte Sicherheilspolitik als Weltordnungspolitik hat der Welt mehr Krieg als Frieden beschert. In diesem Punkt hat er sich geirrt. Die USA haben die Chance nach dem Ende des Ost-West-Konflikts bekommen, ihre eigenmächtige Weltordnungspolitik zu betreiben. Gut dreißig Jahre danach erweist sich die von der einzig verbliebenen Supermacht errichtete unipolare Weltordnung weder als tragfähig noch als friedlich oder sicher.
Sie ist gescheitert, weil sie keine befriedete Weltordnung dauerhaft garantieren konnte. Warum scheiterte dieses in der Weltgeschichte einmalige und einzigartige Experiment mit seinem Versuch, die globale Führerschaft von einem einzigen Zentrum errichten zu wollen?
Die USA wollten kraft eigener Vollkommenheit das Schicksal der Welt bestimmen und die Spielregeln der Weltpolitik diktieren. Das war sicherlich Utopie und Hybris zugleich. Im Aufstieg zur Welthegemonie war der Niedergang schon beschlossen, auch wenn die Kräfte noch ausreichen, um dem US-Hegemon die Macht – freilich ohne Perspektive – für längere Zeit zu erhalten.
Carters Zukunftsvision von einer Weltordnungspolitik ohne „die Politik des Gleichgewichts der Kräfte“ stand voll und ganz in der Tradition der „One World“-Idee5 und nicht zuletzt Woodrow Wilsons schroffer Ablehnung des europäischen Machtgleichgewichts, die weit in die Anfänge des US-amerikanischen außenpolitischen Denkens zurückreicht.
„Der ganze Unsinn in puncto Gleichgewicht der Kräfte“, hatte eine US-amerikanische Zeitschrift schon 1852 verkündet, „ist ganz und gar überholt, und die Lehre von der Solidarität der Menschen beginnt sich auszubreiten; die Volkssouveränität schickt sich an, das Legitimitätsprinzip sehr rasch zu verdrängen.“6
Und so lehnte der bereits erwähnte US-Präsident Woodrow Wilson getreu dieser außenpolitischen Weltanschauung den Grundsatz des Kräftegleichgewichts auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 im Schloss von Versailles vehement ab. Wilson vertrat die Auffassung, dass die Politik des Machtgleichgewichts „eine Erfindung der Staaten gewesen (sei), die chronisch einem absolutistischen, militärischen und antidemokratischen Selbstverständnis verhaftet gewesen seien und deren Bündnisakrobatik und Intrigenspiel den Ausbruch des Krieges im Jahr 1914 herbeigeführt hätten.“7
Bereits am 22. Januar 1917 erläuterte Wilson in seiner Rede vor dem US-Senat die Grundprinzipien seines „Friedens ohne Sieg“:
„Was nottut, ist nicht ein Gleichgewicht der Macht, sondern eine Gemeinschaft der Mächte … Ich schlage … vor, dass alle Nationen sich künftig bindender Bündnisverträge enthalten, die geeignet sind, sie in machtpolitische Konkurrenzkämpfe zu verwickeln, sie in ein Netz von Intrigen und selbstsüchtigen Rivalitäten zu verstricken … In einem Konzert der Mächte gibt es keine bindenden Bündnisverpflichtungen. Wenn alle sich zusammentun, um in die gleiche Richtung und auf das gleiche Ziel hin zu wirken, so werden alle im gemeinsamen Interesse handeln und unter einem gemeinsamen Schutzschirm ungehindert ihr eigenes Leben führen.“ (ebd., 67 f.)
Und in seiner Rede in der Londoner Guild Hall am 28. Dezember 1918 erklärte er, die Soldaten der Alliierten hätten
„gekämpft, um eine alte Ordnung zu beseitigen und eine neue aufzurichten, und den Mittelpunkt und das Charakteristikum der alten Ordnung bildete jene ehrwürdige Sache, die wir gewöhnlich das >Gleichgewicht der Kräfte< nannten – eine Waage, deren Neigung bestimmt wurde durch das in die eine oder andere Schale geworfene Schwert; eine Balance, die sich gründete auf das instabile Gleichgewicht konkurrierender Interessen; eine Balance, die aufrechterhalten wurde durch eifersüchtige Wachsamkeit und einen Antagonismus der Interessen, der zwar im allgemeinen latent blieb, aber immer tief gründete. Die Männer, die in diesem Krieg gekämpft haben, waren Männer aus freien Nationen, entschlossen, dafür zu sorgen, dass es mit dieser Art der Politik ein für alle Mal ein Ende hat.“ (ebd., 68)
Wilsons Äußerungen kommentierend, sprechen Craig/George von einer „einseitigen Auffassung“ und dem verzerrten „Bild“, das „Wilson sich vom System des Kräftegleichgewichts machte“. Es war „insofern unvollständig, als es sich einzig und allein auf die instabile nach-bismarcksche Variante bezog.“
Wilson präsentiere sich hier nach Craig/Georges Auffassung „nicht so sehr als Historiker denn als Visionär“, dessen außenpolitisches Credo darauf beruhe, „dass die Beziehungen zwischen den Völkern der Welt nicht nach den überholten Grundsätzen der europäischen Politik gestaltet werden sollten, sondern nach den demokratischen Prinzipien.“8
Wilsons Beurteilung des europäischen Kräftegleichgewichts war nicht nur „einseitig“, wie Craig/George beschwichtigend beteuern, sondern von Grund aus falsch. Zwar hat das im 18./19. Jahrhundert bestehende europäische Gleichgewichtssystem die zwischenstaatlichen Kriege einhegen können. Kriege zu verhindern, war aber weder das Ziel noch der Sinn des europäischen Gleichgewichts.
Es war vielmehr ein System von Macht und Gegenmacht, wodurch die Großmächte sich wechselseitig beschränkten, um die Welthegemonie oder gar die Weltherrschaft einer Großmacht zu verhindern.9
Und genau das ist nach dem Ende des Ost-West-Konflikts eingetreten. An die Stelle des sog. „Gleichgewichts des Schreckens“ trat keine neue Machtbalance, sondern eine Macht-Dysbalance als ein neues strukturbildendes Ordnungsprinzip der europäischen Sicherheitspolitik, welches das Machtgleichgewicht in Europa zu Lasten Russlands beseitigte.
Diese Entwicklung war absehbar, aber nicht unabwendbar. Sie führte letztlich zur Entstehung und Ausbildung der sog. „unipolaren Weltordnung“ unter der Führung des US-Hegemonen. Es entstand mit anderen Worten eine Art überstaatlicher Ordnung, die immer mehr Züge eines „Weltstaates“ angenommen hat.
Das eigentliche Problem eines solchen Machtgebildes besteht ja nach Hannah Arendt darin, „dass die letzte Instanz nicht überstaatlich sein darf. Eine überstaatliche Instanz würde entweder wirkungslos sein oder von dem jeweils Stärksten monopolisiert werden und so zu einem Weltstaat führen. Das dürfte wohl das tyrannischste Gebilde sein, das sich überhaupt denken lässt, vor dessen Weltpolizei es dann auf der ganzen Erde kein Entrinnen mehr geben würde, bis er schließlich auseinanderfällt.“10
Diese geradezu prophetische Vorwegnahme dessen, was Arendt als „Weltstaat“ nannte und heute eine „unipolaren Weltordnung“ genannt wird, findet vor unseren Augen statt. Die unipolare Weltordnung hat sich zu einem „tyrannischsten Gebilde“ entwickelt, das nunmehr nach einem dreißigjährigen Bestehen zerfällt bzw. >auseinanderfällt<.
Die nach dem Ende des „Kalten Krieges“ entstandene Macht-Dysbalance als das strukturbildende Ordnungsprinzip hat sich sicherheitspolitisch nicht bewährt und letztlich zum Krieg in Europa geführt. Wer wie die USA als Ordnungsmacht in Europa die Machtbalance beseitigt und an die Stelle des „Gleichgewichts des Schreckens“ ein Machtungleichgewicht etabliert, garantiert – wie man sieht – keine dauerhafte Sicherheitsordnung in Europa.
Das ist die Lehre, die wir heute aus dem Ukrainekonflikt ziehen können und müssen. An einer Wiederherstellung des Machtgleichgewichts in Europa in welcher Form auch immer kommt kein Weg vorbei. Das Beharren der USA als hegemoniale Ordnungsmacht, die europäische Sicherheitspolitik weiterhin zu domestizieren, führt unweigerlich zu einem großen europäischen Krieg, zumal die USA heute nicht mehr in der Lage sind, Russland die geo- und sicherheitspolitischen Bedingungen in Europa diktieren zu können. Diese Zeiten sind unwiderruflich vorbei.
3. Machtstaatspolitik als Sicherheitspolitik?
1997 spekulierte Werner Link (1934-2023) über ein sicherheitspolitisches Äquilibrium in der Hoffnung auf ein neues Balancesystem zwischen Russland und dem Westen nach dem Ende des „Kalten Krieges“. „Russland“ – meinte Link – „will die Osterweiterung (zumindest die der Nato) verhindern und verfolgt seinerseits … die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Re-Integration seines Vorfeldes … Ob Integration und Re-Integration gelingen werden, ist hier wie dort … eine offene Frage. Wenn sie gelängen, so würde sich ein neues Balancesystem zwischen EU und Nato einerseits und Russland und der von ihm geführten GUS andererseits herausbilden, in dem die Machtrelation für den Westen … äußerst günstig ausfiele.“11
Ein Vierteljahrhundert später tobt ein blutiger Krieg in Europa. Russland ist es ebenso wenig gelungen, die Nato-Osterweiterung zu verhindern, wie „ein neues Balancesystem“ zwischen Russland und dem Westen herzustellen. Stattdessen entstand eine die gesamteuropäische Sicherheit gefährdende Macht-Dysbalance – ein Machtungleichgewicht, das die Sicherheitsordnung in Europa bis heute nicht nur prägt, sondern auch zum Krieg auf ukrainischem Boden geführt hat.
Die „Machtrelation“ hat sich nach dem Ende der bipolaren Weltordnung zu Gunsten des Westens verschoben. Und nun unternimmt Russland drei Dekaden später einen militärischen Kraftakt, um diese „Machtrelation“ zumindest teilweise zu nivellieren. Dabei stehen die Chancen für Russland gar nicht so schlecht.
Der US-Hegemon befindet sich geopolitisch und geoökonomisch auf dem Rückzug, der Nichtwesten emanzipiert sich mit beschleunigtem Tempo vom Westen und nicht zuletzt an der ukrainischen Front sieht es für Russland momentan besser aus denn je.
China und Russland rücken militärisch, ökonomisch, monetär und technologisch immer enger zueinander und es entsteht eine mächtige informelle Allianz, der schon heute der konsolidierte Westen nicht (mehr) gewachsen ist. Nicht einmal mehr auszuschließen ist, dass die chinesischen Militärangehörigen im Notfall an der russischen Westfront Seite an Seite mit Russen gegen den Westen kämpfen würden, wenn es darauf ankäme.
Und da sprechen manche westlichen Möchtegern-Strategen von einer „Isolierung“ Russlands. Sie merken nicht, dass der Westen allmählich sich selbst vom Rest der Welt isoliert.
Die ganze Entwicklung wäre vermeidbar gewesen, wenn die US-Russlandpolitik seit der Clinton-Administration nicht auf Expansion, sondern auf Kooperation, nicht auf Macht-Dysbalance, sondern auf ein neues Balancesystem, nicht auf eine Weltordnungspolitik „nach den demokratischen Prinzipien“ (Woodrow Wilson, Jimmy Carter, Bill Clinton u. a.), sondern auf eine antihegemoniale Machtpolitik gesetzt hätte.
Das wäre freilich eine Utopie. Zu schwach war das postsowjetische Russland der 1990er-Jahre und danach, die USA zu übermächtig. Eine solche antihegemoniale Machtpolitik wäre noch vor wenigen Jahren ein Ding de Unmöglichkeit. Zu sehr waren die USA eine „Weltmacht ohne Gegner“, um eine Gegenmacht neben sich gelten zu lassen.
Dass Russland in der auf die Expansion angelegte US-Sicherheitspolitik „die Gefahr einer Hegemonie“ sah, hat Werner Link bereits 1997 klar und deutlich erkannt.
„Wenn die amerikanischen Befürchtungen, die von Huntington und anderen angesichts einer potentiellen europäischen Macht als real angesehen werden, muss dies erst recht für die russischen Befürchtungen gegenüber einer europäisch-amerikanischen Macht gelten … Anders als die europäisch-amerikanischen Beziehungen sind die Beziehungen des politischen Europas und der USA zu Russland eben nicht nur durch ökonomischen Wettbewerb (>geo-economics<), sondern auch durch machtpolitischen Wettbewerb (>geo-politics<) charakterisiert … Im Falle einer neuen akuten hegemonialen Bedrohung wäre die Entwicklung eines antagonistischen Gleichgewichtssystems wahrscheinlich.“12
Statt eines „antagonistischen Gleichgewichtssystems“ hat sich allerdings ein hegemoniales Ungleichgewichtssystem als strukturbildendes Ordnungsprinzip der europäischen Sicherheit etabliert. Betrachtet man dieses hegemoniale Ungleichgewichtssystem rein ordnungstheoretisch, so erblickt man darin einen Denkansatz, dem gleichzeitig die US-Geopolitik, die westliche Axiologie und die Nato-Expansion zugrunde liegt und der darum sicherheitspolitisch dysfunktional ist, weil er auf Dauer keine Sicherheit, sondern Unsicherheit generiert.
Dieser dysfunktionale Dreiklang hat von vornherein jede Chance auf die Herstellung eines neuen Balancesystems unterbunden.
Um diese ordnungspolitische Dysfunktionalität besser ordnungstheoretisch verstehen zu können, müssen wir Kissingers Analyse des „europäischen Machtkonzerts“ heranziehen. Die vom Wiener Kongress (1814/15) ins Leben gerufene europäische Friedens- und Sicherheitsordnung bescherte Europa einen auf dem „europäischen Machtkonzert“ ruhenden hundertjährigen Frieden, den Kissinger auf eine ebenso griffige wie fragwürdige Formel brachte: „Das Gleichgewicht der Macht verhindert den Umsturz der internationalen Ordnung; gemeinsame Werte verhindern das Bestreben, die internationale Ordnung umzustürzen.“13
Dass das Machtgleichgewicht die europäische Staatenwelt des 19. Jahrhunderts von Umwälzungen verschonte, ist ein historisches Faktum. Dass aber die „gemeinsamen Werte“ und nicht die historisch gewachsenen Macht- und Lebensstrukturen dafür verantwortlich waren, ist ein Mythos. Das politische Denken in Begriffen von Wert und Unwert ist das Denken des 20. Jahrhunderts – eines Jahrhunderts der Ideologien – und nicht das Machtstaatsdenken des langen 19. Jahrhunderts. Die Machtstaatspolitik des 19. Jahrhunderts war eine ideologiefreie, auf der Staatsräson beruhende Machtpolitik.
In der Tradition des US-amerikanischen außenpolitischen Denkens stehend, vermengt Kissinger mit seinem griffigen Spruch unreflektiert die Machtstaatspolitik des 19. Jahrhunderts mit der Weltordnungspolitik des 20. Jahrhunderts. Werden diese zwei sich selbst ausschließenden Ordnungsvorstellungen miteinander vermengt, so wird das darauf gegründete geo- und sicherheitspolitische Ordnungssystem implodieren und nicht überleben.
Das Gleichgewichtssystem des 19. Jahrhunderts beruhte auf dem Ordnungsprinzip, „dass die Beschaffenheit der Machtbeziehungen der Staaten untereinander ein Übergewicht einer Macht oder einer Mächtegruppe über die andere oder die anderen verhindere und damit auch jeden Vorstoß zu einer Veränderung des Systems durch Krieg faktisch unmöglich, weil militärisch aussichtslos machte. Das Selbstinteresse der Staaten sollte in dieser Ordnung in einem sonst nicht erreichten Grad mit dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens identisch sein. Macht sollte Macht eindämmen, durch Macht Abschreckung vor Krieg eintreten.“14
Was aber nach dem Ende des Ost-West-Konflikts geschah, ist nicht die Aufrechterhaltung, sondern die Beseitigung des Gleichgewichts und die Entstehung einer Macht-Dysbalance – eines Ungleichgewichtssystems – als strukturbildendes Ordnungsprinzip der europäischen Sicherheit, das „ein Übergewicht einer … Mächtegruppe“ – der Nato-Staaten – etablierte, wodurch ein neuartiges Strukturelement in die europäische Sicherheitsordnung Eingang gefunden hat: die Nato-Expansionspolitik.
Der Übermacht der Nato-Staaten stand keine Gegenmacht gegenüber, die die Nato-Expansion eindämmen und ein neues Balancesystem herstellen könnte.
Indem die Macht-Dysbalance als neuartiges Ordnungsprinzip der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung die US-Geopolitik, die westliche Axiologie und die Expansionspolitik miteinander vermengte, hat es sich sicherheitspolitisch als nicht funktions- und tragfähig, weil friedensgefährdend erwiesen.
Geopolitik, Axiologie und Expansion lassen sich ordnungstheoretisch nicht zu einer kohärenten europäischen Sicherheitspolitik als Weltordnungspolitik verschmelzen. Lag dem am Gleichgewicht orientierten Machtstaatsdenken des 19. Jahrhunderts die Staatsräson zugrunde und waren die Zeiten des „Kalten Krieges“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom ideologischen Systemwettbewerb geprägt, so fand in den vergangenen dreißig Jahren (1991-2021) mit der Entstehung der Macht-Dysbalance infolge der Überwindung des „Gleichgewichts des Schreckens“ die US-Ordnungspolitik statt, die – Geopolitik, Axiologie und Expansion verschmelzend – sukzessiv die sicherheitspolitische Spannungen eher erhöhte als abbaute und dadurch mehr Unsicherheit als Sicherheit generierte.
Die Folgen sind einerseits die Entstehung einer Gegenmacht, die sich gegen die Macht-Dysbalance mit dem Ziel wehrt, eine antihegemoniale Friedens- und Sicherheitsordnung zu schaffen. Und andererseits findet infolgedessen die Rückkehr des Machtstaatsdenkens in der Sicherheitspolitik statt.
Die Rückkehr der Machtstaatspolitik führt wiederum entweder zu einer weiteren Zuspitzung und Konfrontation, falls die axiologisch und expansionistisch geleitete US-Weltordnungspolitik die westliche Sicherheitspolitik weiterhin bestimmt, oder zu einem neuen Balancesystem, falls die US-Geopolitik von der Axiologie und Expansion entkoppelt wird und die geopolitischen Rivalen sich machtpolitisch auf einen Modus Vivendi einigen.
Momentan sieht es aber eher danach aus, als würden die Ideologen der Weltordnungspolitik die westliche Sicherheitspolitik maßgeblich bestimmen. Das zeigt nur, wie wenig sie aus den vergangenen zwei Kriegsjahren gelernt haben und wie sehr sie nach wie vor einer maßlosen Selbstüberschätzung unterliegen.
Es führt aber kein Weg daran vorbei, mit Russland einen machtpolitischen Modus Vivendi anzustreben, statt vergeblich davon zu träumen, Russland irgendwann und irgendwie eine „strategische Niederlage“ zuzufügen. Diese Ideologen sind auf dem Holzweg.
Es führt auch kein Weg daran vorbei, die Geopolitik von der Axiologie und Expansion zu entkoppeln. Ihre Verschmelzung macht die europäische Sicherheitsordnung dysfunktional, weil sie Unsicherheit generiert, statt Sicherheit zu gewährleisten.
Die Zeit spielt im Zweifel für Russland und gegen die bestehende, auf der Macht-Dysbalance gegründete Sicherheitsordnung in Europa. Diese zerfällt vor unseren Augen, weil sie keine Sicherheit (mehr) generieren kann.
Ob sie das wollen oder nicht, müssen sich die beiden verfeindeten geopolitischen Kontrahenten machtpolitisch einigen.
Denn eine weitere Chaotisierung des europäischen Kontinents birgt in sich die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation, die zur friedensgefährdenden Situation für ganz Europa führen kann. Das liegt zumindest nicht im Eigeninteresse der Kontinentaleuropäer, auch wenn die Angelsachsen womöglich ganz anderer Meinung sind und damit gut leben können.
Wir erleben eine geo- und sicherheitspolitische Zäsur in Europa. Und diese Zäsur hat kein geringerer als Putin am 19. Dezember 2023 auf seine Art und Weise auf einen Nenner gebracht: „Те страны, которые потеряли свои территории (в пользу Украины), прежде всего Польша, спят и видят, как вернуть их. … В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины“ (Die Länder, die ihre Territorien verloren haben (zugunsten der Ukraine), vor allem Polen, träumen nur davon, wie sie sie zurückholen können. … In diesem Sinne könnte allein Russland der Garant der territorialen Integrität der Ukraine sein).
Es sei dahingestellt, ob diese Sichtweise richtig oder falsch ist. Nur eins wird klar: Die Machtstaatspolitik des 19. Jahrhunderts – die Machtpolitik der Staatsräson – ist zurückgekehrt und diese Entwicklung zeigt die ganze Dramatik der aktuellen sicherheitspolitischen Lage in Europa.
Anmerkungen
1. Weltmacht ohne Gegner: Amerikanische Außenpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Internationale
Politik und Sicherheit), hrsg. v. Peter Rudolf u. Jürgen Wilzewski. Baden-Baden 2000.
2. Ball, G. W., Kalte Kriegsmanie im Weißen Haus, in: Wilhelm Bittorf (Hg.), Nachrüstung. Der
Atomkrieg rückt näher. 1981, 167-170 (167).
3. Zitiert nach Lewis, F., Wenn Europa an Krieg denkt, in: Wilhelm Bittorf (wie Anm. 2), 199-201 (199).
4. Zitiert nach Barnet, R. J., Wie es zur neuen Politik der Stärke kam, in: Wilhelm Bittorf (wie Anm. 2), 171-
175 (171).
5. Silnizki, M., One World. Utopie oder Zukunftsvision? 3. Januar 2022, www.ontopraxiologie.de.
6. Zitiert nach Craig, G. A./George, A. L., Zwischen Krieg und Frieden. Konfliktlösung in Geschichte und
Gegenwart. München 1984, 68.
7. Craig/George (wie Anm. 6), 67.
8. Craig/George (wie Anm. 6), 68.
9. Vgl. Link, W., Die europäische Neuordnung und das Machtgleichgewicht, in: Thomas Jäger/Melanie
Piepenschneider (Hrsg.), Europa 2020. Szenarien politischer Entwicklungen. Opladen 1997, 9-31 (11).
10. Arendt, H., Macht und Gewalt. München/Zürich 1985, 131.
11. Link (wie Anm. 9), 29.
12. Link (wie Anm. 9), 29, 31.
13. Zitiert nach Stürmer, M., Die Kunst des Gleichgewichts. Europa in einer Welt ohne Mitte. München 2001,
40.
14. Schieder, Th., Friedenssicherung und Staatenpluralismus, in: des., Einsichten in die Geschichte. Essays.
1979, 156-174 (169).