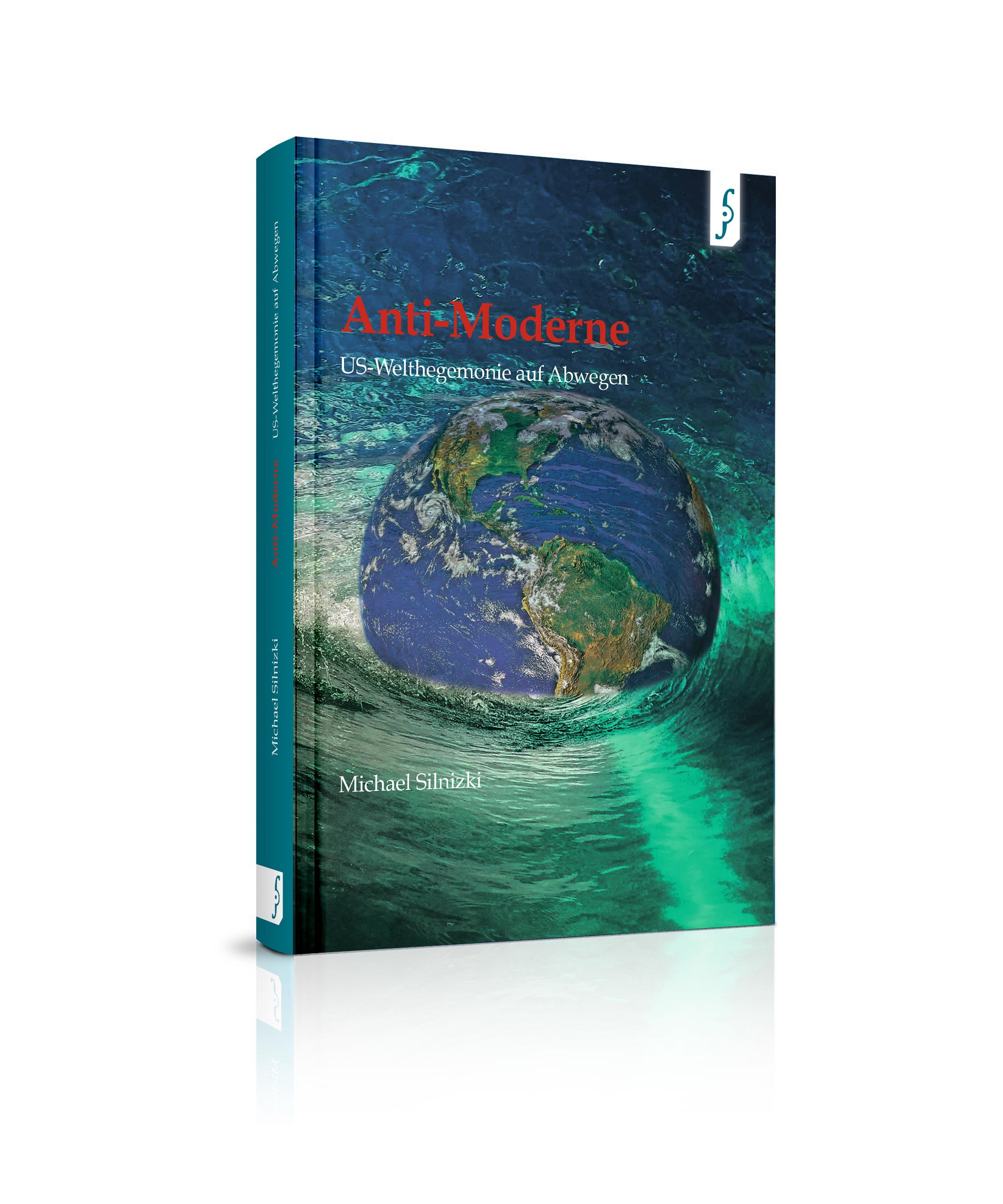Von der „dangerous naiveté“ in der US-Außenpolitik
Übersicht
1. Ein desillusionierter Neocon
2. „Demokratieexport“ aus einerverfassungshistorischen Sicht
3. Vom „liberalen Idealisten“ zum „liberalen Realisten“?
Anmerkungen
„Ах, обмануть меня нетрудно!..Ясамобманыватьсярад!“
(Ach, es ist nicht so schwer, mich zu täuschen!
Ich bin ja selber froh, getäuscht zu werden!)
(Alexander S. Puškin, 1826)
1. Ein desillusionierter Neocon
Erstaunliche Dinge passieren heute im außenpolitischen US-Establishment. Was gestern noch als höchste Werte und Ideale gegolten haben, erscheinen heute nicht zuletzt in Anbetracht des Ukrainekonflikts in einem ganz anderen Licht.
Erstaunt nimmt man zur Kenntnis, dass die Außenwelt von manchen Repräsentanten des US-Establishmentsnicht mehr virtualisiert und von der virtualisierten US-Außenpolitik als „Realität“ wahrgenommen und begriffen wird. Wird etwa auf diese Weise die Schein-Wirklichkeit der Außenwelt einer realistischeren, ideologiefreieren Analyse unterzogen?
Auf den ersten Blick scheint es so zu sein. Wir erleben eine wundersame Metamorphose eines außenpolitischen Repräsentanten des US-Establishments.Aus einem Falken wird auf einmal eine Taube, aus einem Kriegstreiber ein Kriegsgegner, aus einem Demokratieförderer eine besonnene Stimme, die vor einem Demokratieexport eindringlich warnt. Ja, selbst die Selbstkritik ist für ihn kein Fremdwort mehr.
Der Bekehrte heißt Max Boot (geb. 1969), den die World Affairs Councils of America 2004 zu einem der „500 einflussreichsten Personen in den USA im Bereich der Außenpolitik“ ernannte – zu jener Zeit also, als die Neocon-Bewegung ihre größten Erfolge feierte. In seinem umfangreichen Aufsatz „What the Neocons Got Wrong“ (Foreign Affairs, 10. März 2023) verrät er bereits im Untertitel seiner bemerkenswerten Schrift „And How the Iraq War Taught Me About the Limits of American Power“, wo ihm der Schuh drückt und worum es ihm eigentlich geht. Der Irakkrieg habe ihn gelehrt, dass die amerikanische Hegemonie ihre Grenzen habe.
Bereits zu Beginn seiner Schrift definiert Boot die Neocon-Bewegung als „eine bestimmte Art von Konservatismus“, der „die Menschenrechte und Demokratieförderung in den Vordergrund der US-Außenpolitik“ stelle. Dieser „Konservativismus“ sei eine ganz andere Denkweise als der realpolitische Ansatz von Republikanern wie Eisenhower, Nixon oder Kissinger.
Und diese konservative Denkweise – gesteht Boot freimutig ein – habe die vergangenen zwanzig Jahre nicht funktioniert. Die „Regime change“-Politik habe in Afghanistan und im Irak versagt und ein regelrechtes „Fiasko“ erlebt. Dieses Erlebnis des Scheiterns führte nun zu seinem Gesinnungswandel, beteuert Boot . Zwar sei er nach wie vor „ein Befürworter von Demokratie und Menschenrechten“ (a supporter of democracy and human rights). Nachdem er aber gesehen habe, wie die Demokratieförderung (democracy promotion) in der Praxis funktioniere, dürfe sie nicht mehr im Zentrum der US-Außenpolitik stehen.
Das Motto: Demokratie ist , wo die USA das Sagen haben , darf alsonicht mehr als Leitidee der US-Außenpolitik gelten.Zwanzig lange Jahre hat der bekennende Neocon gebraucht, um sich zu dieser Erkenntnis durchzudringen. „Rückblickend war ich zu optimistisch“ –sinniert Boot -, was „einen gewaltsamen Demokratieexport“ (exporting democracy by force) angehe, und habe sowohl die Schwierigkeiten als auch die Kosten eines solches Abenteuers unterschätzt. „Ich bin kein Neokonservativer mehr, zumindest so wie dieser Begriff seit 9/11 verstanden wird“ (I am a neocon no more, at least as that term has been understood since 9/11).
„Heute bin ich mir den Grenzen der amerikanischen Macht bewusst und daher viel skeptischer gegenüber den Aufrufen zur Förderung der Demokratie in China, Ägypten, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien, der Türkei, Venezuela“ usw. Die USA sollten sich weiterhin für ihre Ideale einsetzen und Menschenrechtsverletzungen anprangern, aber sie sollten dies „mit Demut“ (with humility) tun und sich nicht schämen, „ihre eigenen Interessen zu priorisieren“. Außenpolitik könne nicht ausschließlich oder auch nur hauptsächlich „eine altruistische Übung“ (altruistic exercise) sein.
Soll das etwa ein Gesinnungswandel sein? „Ein gewaltsamer Demokratieexport“ (exporting democracy by force) wird nach wie vor als „eine altruistische Übung“ (altruistic exercise) aufgefasst und der Förderung von Demokratie und Menschenrechten als „Idealen“ der US-Außenpolitik nicht grundsätzlich abgeschworen. Das ist kein Gesinnungswandel und keine Bekehrung eines Neocons, der „mit Demut“ die Militarisierung der US-Außenpolitik bzw. „Enttabuisierung des Militärischen (Lothar Brock ) bereut. Wäre das gescheiterte Demokratisierungsexperiment erfolgreich, so hätte Boot die US-Außenpolitik der vergangenen zwanzig Jahre nie bereut.
Es geht hier nicht so sehr um eine Reue, als vielmehr um das Eingeständnis der Ohnmacht der von der Neocon-Bewegung konzipierten US-Außenpolitik, welche eine Demokratisierung der fremden Kultur- und Machträume mit militärischer Gewalt zu implementieren suchte. Es geht darüber hinaus um die Erkenntnis der Grenzen der US-Hegemonialmacht, deren „gewaltsamer Demokratieexport“ kontraproduktiv war und die US-Außenpolitik in eine Sackgasse geführt hat.
Aus dieser bitteren Erkenntnis ergibt sich für Boot folgerichtig, dass die USA beim Einsatz militärischer Gewalt (the use of military power) vorsichtiger als in den berauschenden Tagen des „unipolar moment“ nach dem Kollaps der Sowjetunion sein müssen.
Statt einer unipolaren Weltordnung sei „die Ära der Großmachtrivalität mit aller Macht zurückgekehrt“ (The era of great-power competition is back with a vengeance), stellt Boot ernüchtert fest und fügt gleich hinzu: Zwar sind die USA nach wie vor die stärkste Militärmacht (the world’s strongest military). Sie können es sich aber nicht mehr leisten, ihre Stärke in Konflikten von marginaler Bedeutung (its strength in conflicts of marginal importance) zu verschwenden.
Diese ernüchternde Erkenntnis eines desillusionierten Neocons ist bemerkenswert. Einerseits erkennt er zutreffend einen sich vollziehenden geopolitischen Wandel im globalen Raum und identifiziert folgerichtig das Ende des „unipolaren Momentums“ sowie die ausgebrochene Großmächterivalität. Dass die Gründe dafür aber nicht allein im vom Siegesrausch über den gewonnenen „Kalten Krieg“ ergriffenen Triumphalismus der USA sowie in den zahlreichen US-Interventionen und Invasionen liegen, verkennt er.
Der Einsatz exzessiver militärischer Gewalt erklärt nämlich bei weitem nicht das Scheitern des US-amerikanischen Demokratieexports und der Implementierung der „Menschenrechte“. Das außenpolitische US-Establishment, dessen prominenter Vertreter Max Boot ist, ignoriert mangels historischer Reflexion weltgeschichtliche Prozesse, deren Unkenntnis eine ganz andere US-Außenpolitik als die der vergangenen zwanzig Jahre verunmöglichte.
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts startete der Westen eine ideologische Offensive im postsowjetischen Raum unter dem wohlklingenden Namen „Demokratieförderung“. Sie erwies sich – wie man heute weiß – als Flop. Man hätte auch nichts anderes erwarten können, hätten die westlichen „Demokratieförderer“ und die US-Geostrategen Kenntnisse von der westlichen Rechts- und Verfassungsgeschichte im Gegensatz zu den Entwicklungen der nichtwestlichen Macht- und Kulturräume gehabt.
„Eines der zentralen Argumente, die ich und andere Befürworter einer Irakinvasion vorbrachten“, war – gesteht Boot freimütig ein -, „dass ein Regimewechsel eine breitere demokratische Transformation im Nahen Osten auslösen könnte. Ich schaudere jetzt, wenn ich einige der Artikel lese, die ich damals geschrieben habe. >Dies könnte die Chance sein …, die erste arabische Demokratie zu errichten und dem arabischen Volk zu zeigen, dass Amerika der Freiheit für sie genauso verpflichtet ist wie wir für die Menschen in Osteuropa<, schrieb ich einen Monat nach 9/11 im Weekly Standard .“
„Den Irak zu einem Leuchtturm der Hoffnung für die unterdrückten Völker des Nahen Ostens zu machen: Das wäre ein historisches Kriegsziel“, zitiert Boot sich selbst weiter und merkt anschließend an: „Im Nachhinein war das eine gefährliche Naivität (dangerous naiveté), die aus einer Kombination von Hybris nach dem Kalten Krieg und Alarmismus nach 9/11(a combination of post–Cold War hubris and post-9/11 alarm) entstand.“
So naiv waren und sind immer noch die Repräsentanten des außenpolitischen US-Establishments. In einem irrt sich Boot allerdings: Die „dangerous naiveté“ ergab sich nicht aus einer Kombination von Hybris und Alarmismus, sondern aus einem unheilvollen Junktim von Machtarroganz und Unbildung.
2. „Demokratieexport“ aus einerverfassungshistorischen Sicht
Demokratie ist ein geopolitischer Kampfbegriff geworden, welcher der innen- und außenpolitischen Komplexität der Moderne nicht gerecht wird. Er kann nur im Horizont einer verfassungshistorischen Entwicklung verstanden werden. Ein universal postulierter Demokratie-Begriff gibt es nicht und im geopolitischen Machtkampf erweist er sich oft als ideologisches Vehikel zwecks Diffamierung und Delegitimierung des geopolitischen Rivalen.
Wie kaum ein anderer Verfassungsbegriff der Gegenwart ist er zu dem wirkmächtigsten Propagandainstrument im nie enden wollenden Informationskrieg geworden. Es gibt aber – stellte Gerhard Leibholz bereits vor 65 Jahren fest – „einen apriorisch feststehenden, von Zeit und Ort unabhängigen Begriff der Demokratie nicht“1.
Wer die Begriffsgeschichte der Demokratie kennt, der weiß, dass noch im späten 19. Jahrhundert „der Begriff Demokratie in der englischsprechenden Welt, aber auch in der romanischen, unter Radikalismus-Verdacht (stand)“. Erst in einem langen quälenden, historischen Prozess hat sich jene demokratische Grundordnung entwickelt, „der außer den primärdemokratischen Elementen der Volkssouveränität und des Mehrheitsprinzips auch so unentbehrliche Bestandsteile unserer öffentlichen Ordnung wie Rechtsstaats- und Repräsentationsprinzip, Parteiensystem und Parlamentswesen angehören“2.
All das sind die Attribute eines parlamentarischen Regierungssystems in einem liberalen Verfassungsstaat, die wir gewöhnlich mit einem schillernden Begriff der Demokratie umschreiben. Aber selbst der Begriff Volkssouveränität , womit wir insbesondere den Demokratie-Begriff assoziieren, ist längst fragwürdig geworden. Martin Kriele hat bereits 1975 deutlich gemacht, dass es im Verfassungsstaat „keinen Souverän“ gibt, da zur Souveränität „das Element der tatsächlichen Herrschaftsmacht“ gehört. Das Volk herrscht aber nicht; es hat lediglich „bestimmte, ihm von der Verfassung zugewiesene Kompetenzen“. Soweit es sich aber „um fest umgrenzte Kompetenzen handelt, kann es sich nicht um Souveränität handeln“3.
Der Demokratie-Begriff wurde letztlich nach dem Ende der Blockkonfrontation in den vergangenen drei Jahrzehnten zunehmend geopolitisiert, aus seinem innenpolitischen Kontext gelöst, axiologisch universalisiert und ja eschatologisch aufgeladen. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Begriff der Demokratie, sondern auch für die Begriffe Rechtsstaat und Menschenrechte , die ebenfalls geopolitisch instrumentalisiert werden.
Aus den westlichen, verfassungspolitisch entwickelten Ordnungsbegriffen werden vulgär-demokratische Verheißungen, welche das Ordnungsgefüge der verfassungshistorisch anders entwickelten Kulturen und Länder zu delegitimieren und zu destabilisieren suchen. Solche Verheißungen können allerdings die traditionellen Machtstrukturen der nichtwestlichen Länder zwar beeinträchtigen und sogar in Unruhe versetzen, letztlich aber weder aushebeln noch ersetzen, weil diese abstrakten Verheißungen im illiberalen Machtumfeld auch illiberal gedeutet werden und darum keine Chance auf ihre im Sinne der liberalen Rechts- und Verfassungsordnung verstandene Realisierbarkeit haben.
Der westliche Gebrauch des Begriffs Demokratie speist sich zudem aus zwei völlig konträren Quellen: zum einen aus einer liberalen Verfassungstradition englischer Provenienz und zum anderen aus einer vulgär-demokratischen und egalitären Verfassungsideologie französischer Herkunft4.
Der westliche Parlamentarismus ist eine Verfassungsform britischer Provenienz, die „geschichtlich und theoretisch . . . aus der Übertragung des Gedankens des gerichtlichen Prozesses auf den politischen Prozess der Gesetzgebung“ zu begreifen ist. „Das Common Law gab es als Richterrecht vor den Gesetzen: Recht entsteht überhaupt als Richterrecht.“5 Das westliche Verfassungs- und folgerichtig auch Demokratieverständnis (!) ist – wie man sieht – seiner Genesis nach bereits rechtlich fundiert. An Stelle von voluntas tritt hier ratio , weil es eben im politischen Prozess keine neutrale Instanz gibt. „Jeder denkbare Schiedsrichter ist . . . doch zugleich Mitglied der Gesellschaft, als solches in Interessen, Ideologien, Traditionen verstrickt und also notwendigerweise Partei.“6
Georg Jellinek hat einst die modernen Parlamente außerhalb Englands als „geschichtslose Institutionen“ bezeichnet und festgestellt, dass „in der ganzen Vergangenheit kaum ein zweites Beispiel derartiger unvermittelter Schöpfung einer Organisation zu finden sei, die den Staat von Grund aus zu ändern bestimmt war“7.
Überträgt man diese „geschichtslosen Institutionen“ auf die nichtwestlichen Macht- und Kulturräume und interpretiert man sie allein im illiberalen Sinne einer vulgär-demokratischen, egalitären Verfassungsideologie etwa als eine Identität von Regierenden und Regierten dahingehend, dass das Volk seine Machtbefugnisse seinen gewählten Repräsentanten, dem Parlament, delegiert und das Parlament sie der Regierung mit der Wirkung delegiert, dass das Volk angeblich durch Vermittlung des Parlaments selbst regiert, und wird diese Verfassungsideologie sodann geopolitisiert, dann, ja dann entsteht in einem nichtwestlichen Kultur- und Machtraum – sollte diese „geschichtslose Institution“ tatsächlich „erfolgreich“ implementiert werden – entweder Chaos oder Anarchie, oder eine rechtlich entbundene, aber demokratisch legitimierte Herrschaftsverfassung.
Und genau dieses Chaos und Anarchie hat der von Max Boot beklagte ergebnislose Einsatz der militärischen Gewalt der USA im Nahen Osten verursacht, ohne dass die verfassungshistorisch bedingte Untragbarkeit dieser Gewaltanwendung jemals begriffen, geschweige reflektiert wurde. Der Versuch, das rechtlich fundierte westliche Demokratieverständnis den nichtwestlichen Ländern zu oktroyieren, gleicht dem Versuch, den Fisch auf seine Fähigkeit zu prüfen, auf dem Trockenen zu leben.
Die nichtwestlichen Macht- und Kulturräume kennen keine im westlichen Sinne verstandene rechtlich gebundene Machtausübung der Staatsgewalt. Hier wird vielmehr unter Berufung auf die demokratische Legitimität eines staatlichen Entscheidungsprozesses die Alleinzuständigkeit des Staates konstruiert, eben weil dieser demokratisch legitimiert ist. Man könnte dieses Verfassungsverständnis in Anlehnung an Karl Loewenstein als „demoautoritär“8 charakterisieren. Eine solche Staatsgewalt zeigt sich als eine rechtlich entbundene Machtausübung, die auf die Mitwirkung weder des Einzelnen noch der Gesellschaft angewiesen ist. Kurzum: Hier geht es um ein Demokratieverständnis im Sinne der potestas legibus absoluta und nicht im Sinne einer verfassungsrechtlichen Bindung der Staatsgewalt.
Liberalem Verfassungsstaat und vulgär-demokratischer Verfassungsideologie, Liberalismus und Demokratie liegen also derart unterschiedliche Denkvoraussetzungen zugrunde, dass der Liberalismus sich im 19. Jahrhundert mit der Monarchie ebenso, wie mit der Demokratie, verbinden konnte. Sie können aber auch „im Gegensatz zueinander treten. Dass der Demokratismus einen antiliberalen Charakter annehmen kann, zeigt sich schon bei Rousseau, der die persönliche Existenz des Menschen dem Prinzip nach aufgehoben und das Individuum schlechthin zur Disposition der Gemeinschaft gestellt hat. Bereits hier ist der einzelne Mensch nicht mehr Subjekt, sondern Objekt – das letztlich gleichgeschaltete Instrument der Volonté Générale.“9
Es wäre deswegen ziemlich abwegig annehmen zu wollen, „dass eine Nation sich eine politische Institution oder ein politisches Verfahren von einer anderen Nation ausborgen und sie in unveränderter Form in ihr eigenes Regierungssystem inkorporieren könnte“10. Diese Erkenntnis von Ernst Fraenkel trifft uneingeschränkt nicht nur auf den postsowjetischen Raum, sondern auch auf die anderen nichtwestlichen Macht- und Kulturräume zu, die weder in der Lage noch gewillt sind, die fremden politischen Institutionen und politischen Verfahren in ihr eigenes Macht- und Herrschaftssystem inkorporieren zu lassen.
Der Traum der Neocon-Bewegung von einer Demokratisierung des Nahe Ostens und/oder Afghanistans nach westlichem Vorbild platzte nicht so sehr wegen der Ohnmacht des US-Hegemonen, der „die Grenzen seiner Macht“ erleben musste, als vielmehr wegen eines völlig abwegigen Versuchs, das westliche Verfassungsverständnis den nichtwestlichen Kultur- und Machträumen oktroyieren zu wollen. Wäre sich die Neocon-Bewegung dieses aussichtslosen Abenteuers vor vornherein im Klaren, so hätte sie es auf dieses Demokratisierungsexperiment gar nicht ankommen lassen.
3. Vom „liberalen Idealisten“ zum „liberalen Realisten“?
„Nach zwei Jahrzehnten bitterer Erfahrung“ bemüht sich der Ex-Neocon Max Boot nun „Idealismus mit den Zwängen des Realismus in Einklang zu bringen“. Zwar wolle er nach wie vor die Menschenrechte fördern und die Demokratie verteidigen, aber eben nicht als ein „vehementer Förderer des Demokratieexports“ (a fervent promoter of exporting democracy). Denn er sei zu dem Schluss gekommen, „dass die US-Außenpolitik nicht darauf fixiert sein sollte, Demokratie zu exportieren.“
Und so vollzieht Boot nach eigenen Angaben den gleichen Wandel, den Walter Lippmann (Amerikas berühmtester Kolumnist der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) vollzogen hat, nämlich einen Wandel von einem „liberalen Idealisten“ zu einem „liberalen Realisten“. Offenbar meint er dabei den von Lippmann verfolgten realpolitischen Ansatz in der Außenpolitik.
Zwar formulierte dieser Ansatz auch den Anspruch auf den universellen Charakter des westlichen Wertekanons als Maß aller Dinge. Lippmann distanzierte sich aber gleichzeitig „von der Idee ihrer ubiquitären Durchsetzbarkeit in einer Welt, die auch er, eben als Realist, vom permanenten Machtkampf und der Konfliktbereitschaft des einzelnen Staates gekennzeichnet sah. In diesem Sinne geht seine klassische Definition von Außenpolitik als Versuch einer Ausbalancierung der nationalen Interessen durch Machterweiterung bzw. -überlegenheit …, rückt sie doch geradezu machiavellistisch, ähnlich wie die Geopolitik , primär das Prinzip >national interest< in den Vordergrund der Betrachtung.“11
Als ein geläuterter Ex-Neocon macht sich Boot nun diesen von Lippmann formulierten Ansatz zu eigen und unterscheidet „zwischen der Verteidigung der Demokratie und dem Export von Demokratie“ (between defending democracy and exporting democracy). Die USA haben nach Boots Überzeugung eine bessere Erfolgsbilanz in Bezug auf die erstere als auf die letztere.
„Vor zwanzig Jahren wurden viele Befürworter eines Regimewechsels im Irak und in Afghanistan, mich eingeschlossen, durch den Erfolg der USA bei der Transformation Deutschlands, Italiens und Japans nach dem Zweiten Weltkrieg in die Irre geführt. Was wir nicht begriffen haben, war, dass diese Länder von einzigartigen historischen Umständen profitierten –einschließlich eines hohen Niveaus der wirtschaftlichen Entwicklung, weit verbreitetem sozialem Vertrauen, starken Staaten und einem unbeschriebenen Blatt, das durch die Niederlage in einem totalen Krieg entstanden ist.“
All das wäre auf Irak und Afghanistan nicht übertragbar und es wäre töricht, dies auch nur zu versuchen. „Die Outsider können lokale Gesellschaften“ –entrüstet sich Boot -„kaum verstehen, geschweige dennsie erfolgreich manipulieren“ (Outsiders can barely understand local societies, much less manipulate them successfully).
Es ist zwar begrüßenswert, dass Boot von einem Befürworter zu einem entschiedenen Gegner des Regimewechsels geworden ist. Die Begründung dieser „wundersamen“ Metamorphose von einem „liberalen Idealisten“ zu einem „liberalen Realisten“ zeigt aber, wie sehr seine Geisteshaltung nach wie vor innerhalb der vorgegebenen ideologischen Denkmuster der US-Außenpolitik verbleibt und wie sehr er immer noch vom Geist des amerikanischen Exzeptionalismus beherrscht wird.
Solange aber das US-Establishment daran festhält, bleibt dieUS-Hegemonialpolitik mit ihrem Expansionsdrang auch mittels militärischer Drohgebärden unverändert bestehen. Dass „Expansion als beständiges und höchstes Ziel aller Politik … die zentrale politische Idee des Imperialismus“ sei, hat schon Hannah Arendt uns gelehrt. „Daher besteht“ ihrer Meinung nach, „wenn er Eroberungen macht, stets die Gefahr der Tyrannis“.12
Das Selbstverständnis einer hegemonial und expansiv ausgerichteten US-Außenpolitik hat Clinton s Außenministerin Madeleine Albright (1997 -2001) prägnant und mit einer nicht zu übertreffenden Offenheit formuliert: „Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann weil wir Amerika sind; wir sind die unverzichtbare Nation. Wir stehen aufrecht und blicken weiter in die Zukunft als andere Nationen.“
In dieser außen- und geopolitischen Tradition stehend, plädierte die ehem. Außenministerin Condoleeza Rice (2005-2009) unlängst in einem Interview für CBS am 26. Februar 2023 wie zu ihrer Amtszeit erneut für die Aufnahme der Ukraine in die Nato, um das geo- und sicherheitspolitische „Vakuum“ in Europa zu überwinden.
Die Ukraine sei ihrer Meinung nach bereits jetzt de facto ein sehr starker Nato-Verbündete und umkehrt. Und ich gehe davon aus, dass dies so bleiben werde, weil ich denke, dass in Zukunft irgendeine Form von Sicherheitsvereinbarungen mit der Ukraine notwendig sein werde. Es sei daher angebracht, bereits jetzt damit zu beginnen, daran zu arbeiten. Im Gegensatz zur Nato ist die Ukraine ein ungeschütztes Territorium. Das bedeute aber, dass inmitten Europas ein sicherheitspolitisches Machtvakuum entstanden sei. „Was auch immer wir tun werden, und ich bezweifle, dass es Artikel Fünf sein wird, wir müssen sicherstellen, dass dieses Vakuum in Zukunft nicht mehr vorhanden ist“ (And that tells you something about leaving a vacuum in the center of Europe and so whatever we do, and I doubt it will be Article Five, we need to make sure that that vacuum isn’t there in the future).
Mit diesem geo-und sicherheitspolitischen Denkansatz stehtRice nicht allein da. Sie repräsentiert das außenpolitische Mainstream-Denken des US-Establishment bis heute. Und daran ändert auch die Bekehrung eines Neocons nichts, solange die USA sich als eine Hegemonialmacht begreifen, die sich nicht nur als eine „Weltmacht ohne Gegner“13positioniert, sondern auch als eine Macht, dieessich leisten kann, die erfolglosen und verlustreichen Interventionskriege führen zu können, ohne daran zugrunde gehen zu müssen.
Die Interventions-und Invasionspolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte, welche die gigantischen monetären Ressourcen verschlungen, einen monströsen Verlust an Menschenleben und einen Imageverlust des amerikanischen „way of life“ verursacht hat, war zwar der wichtige, aber bei Weitem nicht der ausschlaggebende Grund für einen Erosionsprozess der US-Hegemonie. Auch die dadurch verursachten Selbstzweifel unseres Ex-Neocons sind lediglich ein Symptom der grundlegenden Probleme der US-Außenpolitik.
Der entscheidende Grund liegt wohl in den immer noch auf den „Kalten Krieg“ zurückgehenden, verkrusteten Denkvoraussetzungen und Denkstrukturen der US-Außenpolitik.Jede außenpolitische Vorgehensweise ist dadurch präformiert, dass sie von ideologisch bedingten Vorverständnissen und systeminhärenten Entscheidungsprozessen, welche die Außenpolitik maßgeblich formen und ihre Urteile und Vorurteile prägen, präjudiziert wird.
Die präformierten Denk- und Entscheidungsstrukturen machen blind und verzerren dadurch komplexe und widerspruchsvolle Realitätsbezüge der Außenwelt, die widerspruchslos erscheinen mögen, weil die ihnen zur Verfügung stehenden Informationsquellen aufgrund vorgegebener eigener, vom determinierten Entscheidungssystem festgelegter, aber nicht mehr überprüfbarer und vor allem nicht hinterfragbarer Wert- und Ordnungsvorstellungen verarbeitet werden.
Die Axiome dieser nicht hinterfragbaren Wert- und Ordnungsvorstellungen erzeugen ein „Syndrom eingebauter Blindheiten“14, das den Nachrichtenstrom von der Außenwelt ideologisiert und wie in einem Zerrspiegel das Zerrbild der geopolitischen Realität wiedergibt, wodurch nur die eigenen im Kern starren, weil auf sich bezogenen, inflexibel gewordenen politischen Denk- und Entscheidungsprozesse selbstbestätigend verdeckt werden, die ihrerseits in besonders hohem Maße internalisiert sind und sakrosankt gelten.
Die etablierten auf den „Kalten Krieg“ zurückgehenden Denkvoraussetzungen erlauben allein nur die Entscheidungsprozesse, die von den festgefahrenen Machtstrukturen längst festgelegt und vorgegeben sind. Hinzu kommt der geopolitische Wandel nach dem Untergang des Sowjetimperiums, der den Aufstieg der USA zur Hegemonialmacht ermöglichte. Die Kehrseite dieses Aufstiegs waren die Überschätzung der eigenen Machtvollkommenheit und das Überschreiten der Grenzen des eigenen Machtpotenzials.
In Kombination mit den zahlreichen außenpolitischen Herausforderungen führte die außenpolitische Handlungs- und Entscheidungsmaschinerie des US-Hegemonen in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem hohen Maß an Destabilisierung weiter Teile des globalen Raumes (mit dem Schwerpunkt des postsowjetischen Raumes, des Nahen Ostens und der Pazifikregion).
Die zunehmenden geoökonomischen und geopolitischen Spannungen zwischen alten und neuen geopolitischen Rivalen Russland und China deckten zudem einerseits die verdeckten inneren Widersprüche der entstandenen hegemonialen bzw. unipolaren Weltordnung auf. Die sich gegenseitig aufhebende Zielsetzung der US-Außenpolitik blieb aber andererseits unverändert bestehen: eine hegemonialmerkantilistisch geleitete Außenwirtschaftspolitik und zugleich Freihandelspolitik; eine von nationalen Interessen geprägte US-Außenpolitik und gleichzeitig die Propagierung von universalen Werten wie Demokratie und Menschenrechte; eine robuste Machtpolitik notfalls mittels militärischer Gewalt und zugleich eine Expansionspolitik im Namen von Humanität und Menschenrechten.
Dieseinnenpolitische und ideologische Knebelung des US-Establishmentsin Verbindungmit dem Sendungsbewusstsein einer „auserwählten Nation“, von der sich auch unser Ex-Neocon trotz seiner anderweitigen Beteuerungen bis heute nicht befreien konnte, macht die US-Außenpolitik erst recht unberechenbar, da sich der sendungsbewusste Missionsgedanke sowohl mit „exzessivem Moralismus“ und Selbstgerechtigkeit als auch mit exzessiver militärischer Gewalt und Machtarroganz verbinden lässt, was wiederum zurSelbstverblendung, Ignoranz und letztlich zur Verhärtung der außenpolitischen Positionen führen kann.
Kurzum: Eine solche inkongruente US-Außenpolitik kann keine kohärente Weltpolitik sein. Sie führt nur zu weltpolitischen Verwerfungen und Spannungen mit Freund wie Feind und kann keine Weltfriedensfunktion erfüllen. Die Missionierung von Demokratie und Menschenrechten hat jedenfalls keine Verbesserung, sondern ganz im Gegenteil eine Verschlimmbesserung und Gefährdung des Weltfriedens gebracht. Das zu erkennen, ist ein Verdienst des Ex-Neocons Max Boot .
Freilich bleibt auch er auf halbem Wege stehen und verkennt zusammen mit dem außenpolitischen US-Establishment einen von Edward A. Freeman (1823-1892) bereits im 19. Jahrhundert formulierten Leitgedanken: „The absurdity of the West is the living reality of the East.“
Anmerkungen
1. Leibholz, G., Strukturprobleme der modernen Demokratie. Karlsruhe 1958, 80.
2. Maier, H., Können Begriffe die Gesellschaft verändern? In: Sprache und Herrschaft. Die umfunktionierten Wörter. Herderbücherei 1974, 55-68 (59).
3. Kriele, M., Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimationsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates. Hamburg 1975, 111, 113.
4. Vgl. Fraenkel, E., Deutschland und die westliche Demokratie. Stuttgart 1964, 53.
5. Kriele (wie Anm. 3), 106.
6. Ebd., 108.
7. Zitiert nach Fraenkel (wie Anm. 4), 20.
8. „Noch im Jahre 1959 hat Karl Loewenstein das Bonner System als >demoautoritär< bezeichnet“ (zitiert nach Fraenkel (wie Anm. 4), 16).
9. Leibholz, G., Demokratisches Denken als gestaltendes Prinzip im europäischen Völkerleben, in: Europa – Erbe und Aufgabe. Internationaler Gelehrtenkongress. Mainz 1955. Hg. v. Martin Göhring. Wiesbaden 1956, 120-135 (125).
10. Fraenkel (wie Anm. 4), 37.
11. Zitiert nach Fröhlich, S., Zwischen selektiver Verteidigung und globaler Eindämmung. Geostrategisches Denken in der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik während des Kalten Krieges. Baden-Baden 1998, 113.
12. Arendt, H., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Bd. II: Imperialismus. Frankfurt/Berlin/Wien 1975, 19.
13. Rudolf, P./Wilzewski, J. (Hrsg.), Weltmacht ohne Gegner. Amerikanische Außenpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Baden-Baden 2000, 65-86.
14. Krippendorff, E., Pax Americana, in: ders., Die amerikanische Strategie. Entscheidungsprozess und Instrumentarium der amerikanischen Außenpolitik. Frankfurt 1970, 19, 439-484 (446).