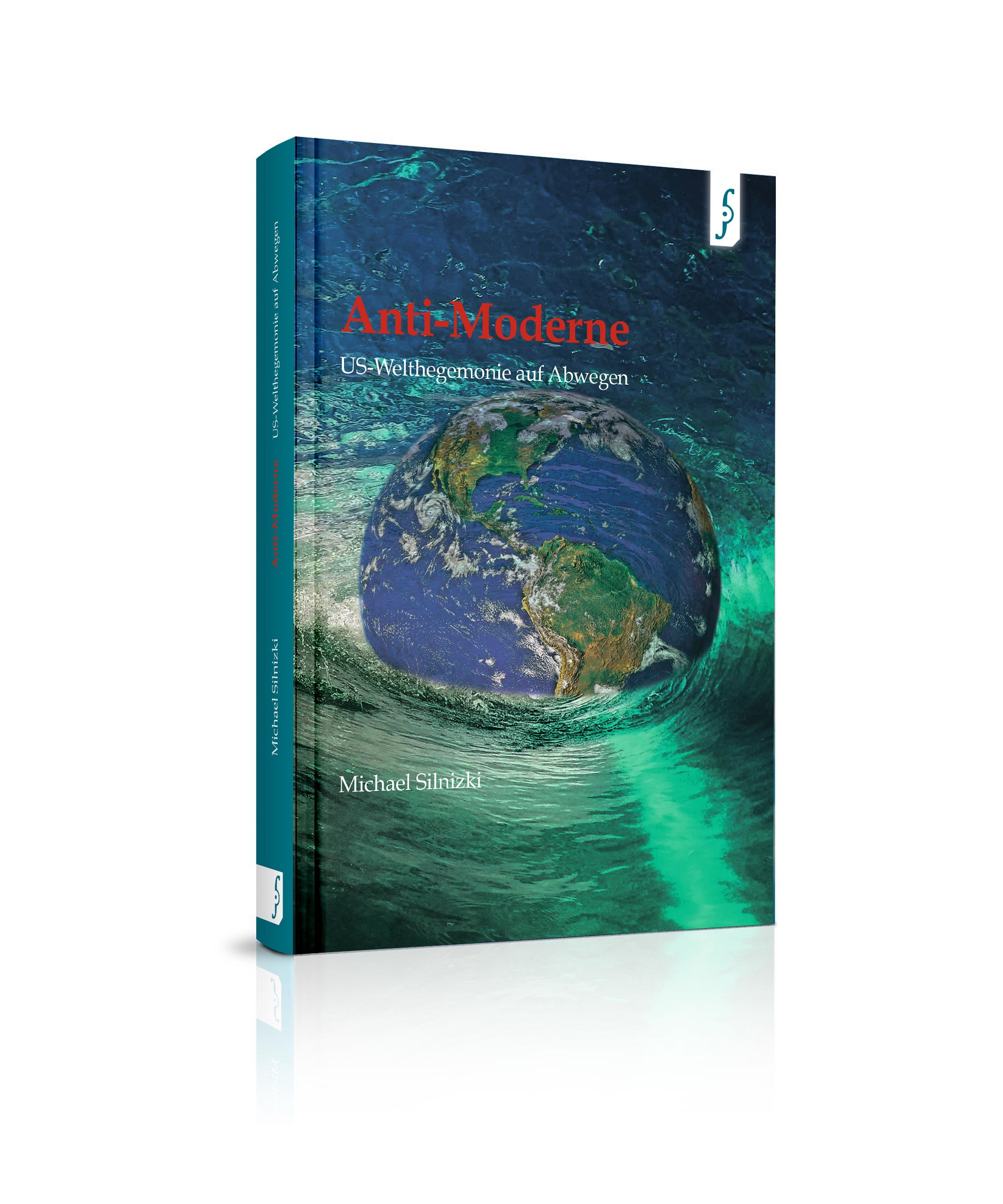Eine gescheiterte Beziehung
Anlässlich der dreißigjährigen Wiederkehr des Untergangs
des Sowjetimperiums
Übersicht
1. Der »Kalte Krieg« ohne Ende?
2. Die gescheiterte US-Interventionspolitik
3. Das Symbol des Scheiterns: Die Ukraine-Krise
Anmerkungen
1. Der »Kalte Krieg« ohne Ende?
Seit dem Untergang des Sowjetimperiums sind dreißig Jahre vergangen und man hat heute das Gefühl, als sei der Kalte Krieg nie zu Ende gegangen. Wie konnte es dazu überhaupt kommen?
Der Aufstieg der USA zur Weltmacht nach dem Ersten und zur Supermacht nach dem Zweiten Weltkrieg fällt mit der Gründung des Sowjetstaates und der Entstehung des Weltkommunismus nach dem Ersten und mit dem Aufstieg des Sowjetimperiums zur Supermacht nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Der Antikommunismus war von Anfang an die ideologische Grundausrichtung der US-amerikanischen Außen- und Weltpolitik. Mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums, der auch den Untergang des Weltkommunismus besiegelte, entfiel die ideologische Legitimationsgrundlage der amerikanischen Außen-, Welt- und Geopolitik.
Das Verschwinden des ideologischen und geopolitischen Rivalen beendete nicht nur den Kalten Krieg, auch wenn die Denkstrukturen des Kalten Krieges vor allem in den westlichen Machteliten bis heute voll intakt sind, sondern leitete gleichzeitig auch – von Zeitgenossen unbemerkt und trotz einer temporären Blütezeit in den 1990er-/Anfang der 2000er-Jahre – das Ende des »amerikanischen Jahrhunderts« ein, das auf eine subtile antipodische Weise auf Gedeih und Verderb mit dem Sowjetimperium verbunden war.
Das zeigt sich vor allem an der nach wie vor fehlenden Neuausrichtung der amerikanischen Russlandpolitik, die – ohne die antikommunistische Rhetorik – nichts anderes im Sinne hatte, als den alten, ideologischen und geopolitischen Kampf gegen einen imaginären – weil mit dem Kommunismus längst untergegangen – Feind nach der gescheiterten Transformation im Russland der 1990er-Jahre wieder aufzunehmen bzw. zu reanimieren.
Nach dem ideologischen Motto: »totalitär, autoritär oder traditionell gleich antiwestlich« vollzog die westliche und insbesondere die US-amerikanische Anti-Russlandpolitik in den vergangenen zwanzig Jahren eine ›Vorwärts in die Vergangenheit‹-Strategie. Die Reanimierung der ideologischen Leiche bringt aber keinen geopolitischen Surplus mit sich – erst recht vor dem Hintergrund von Chinas Aufstieg zu dem mächtigsten geoökonomischen Gegenpart des Westens. Diese ideologische Leichenschau ist der beste Beitrag zu Russlands Abkopplung vom Westen.
Nach dem geopolitischen Motto: »The absurdity of the West is the living reality of the East« (Edward A. Freeman) treibt die US-amerikanische Geopolitik Russland direkt in die Hände Chinas und fördert damit unweigerlich ein geopolitisches Bündnis zwischen China und Russland. Ob der Westen unter Führung des US-Hegemons einem solchen geopolitischen Bündnis gewachsen ist, ist mehr als zweifelhaft.
Statt Russland aber im geopolitischen und geoökonomischen Kampf gegen China auf die eigene Seite zu ziehen, treiben die westlichen Machteliten unter Führung der USA Russland, und zwar mit großem Erfolg, in das chinesische Lager. Was für eine »glanzvolle« geostrategische Leistung der westlichen Machteliten! Trump hat ja vergeblich versucht, Russland für sich zu gewinnen, und zwar gegen einen
erbitterten Widerstand der US-Demokraten, die bereits zu Zeiten Clintons und Obamas mit ihrer China-Politik geostrategisch kläglich versagt haben. Die US-Demokraten leben immer noch in der Welt des Kalten Krieges, obschon dieser seit dreißig Jahren mausetot ist. Sie haben nicht verstanden, dass sie, wenn sie sich allein auf ökonomische Beziehungen zu China konzentrieren und die Geoökonomie als Funktion der Geopolitik geostrategisch vernachlässigen und durch einen ökonomischen Profit substituieren, mittel- und langfristig weder Profite erzielen noch ein Hegemon bleiben werden. Erst die Biden-Administration korrigiert neuerdings die China-Politik der US-Demokraten, aber nur deswegen, weil sie nahtlos Trumps China-Politik übernommen bzw. fortgesetzt hat.
Ohne die Bekämpfung des Kommunismus als das zentrale Leitmotiv des Kalten Krieges hat die US-Außenpolitik ihre ideologische Legitimationsgrundlage verloren und befindet sich trotz Propagierung der sog. »westlichen Werte« in einer ideologischen Sackgasse. Verfassungs- und Menschenrechtsideologie ist eben kein Ersatz zum Antikommunismus, weil sie weder sicherheitspolitische noch geoökonomische Funktion erfüllt; sie kann zwar als Funktion der Geopolitik eine massenpsychologische bzw. massenmanipulierende Wirkung auf die außerwestlichen Kultur- und Machträume ausüben, indem sie durchaus innenpolitische Unruhen und soziale Verwerfungen auslösen kann, aber keinen westlichen Verfassungsliberalismus implementieren.
Die die Welt ordnende Rolle des US-Hegemons verliert heute ideologisch und geopolitisch an Anziehungskraft, sodass man der aus dem Jahr 1996 stammenden und immer noch gültigen Erkenntnis von Herbert Dittgen nur zustimmen kann: Mit dem Ende des Kalten Krieges sind »der interne Kompass und die externe geopolitische Landkarte abhandengekommen«.
Die US-Außenpolitik habe »nach dem Verschwinden der sowjetischen Bedrohung keinen neuen Fokus gefunden …, dass für die Strategie des Containments noch kein entsprechender Ersatz formuliert worden ist.«1
Eine neue Ersatzstrategie existiert auch bis heute nicht, sieht man von einer mit zunehmenden Intensität seit der 2014 ausgebrochenen Ukraine-Krise praktizierten altbekannten Eindämmungs- und Isolierungspolitik ab, die eher ein Zeichen der Fantasie- und Ratlosigkeit der westlichen Machteliten denn eine vielversprechende, zukunftsorientierte Geostrategie manifestiert. Die fehlende affirmative US-amerikanische Russlandpolitik ist und bleibt nach dem Ende des Kalten Krieges das Kernproblem der Beziehungen zwischen Russland und den USA, was die Tendenz zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen China und Russland nur noch beschleunigt und verstärkt. Soll eine solche Entwicklung wirklich im Interesse der US-amerikanischen Geopolitik sein?
Welche Russlandpolitik wäre aber nach der Beendigung des Kalten Krieges praktikabel oder angemessen? Der Westen hat sich nach dem ideologischen Sieg über den Sowjetkommunismus für eine axiologische Offensive im postsowjetischen Raum entschieden, ohne Rücksicht auf eine völlig andere historische und kulturelle Tradition zu nehmen. Dieser axiologische Geltungsanspruch des Westens führte seine Russlandpolitik letztlich in eine geopolitische Sackgasse, obwohl die anfänglichen Erfolge unbestreitbar beachtlich waren:
(1) Das Sowjetimperium ist – wie noch nie in der russischen Geschichte – in die einzelnen staatsähnlichen Machtgebilde zerfallen.
(2) Die NATO expandierte erfolgreich gen Osten.
(3) Das Russland der 1990er-Jahre lag am Boden: politisch, ökonomisch, ideologisch und hat im globalen Raum keine Rolle mehr gespielt.
(4) China war ökonomisch noch zu schwach und es sah alles danach aus, als ob die sog. »liberale Demokratie« verfassungspolitisch, marktwirtschaftlich und axiologisch weltweit triumphierend auf dem Vormarsch ist. Jedes wie auch immer geartete Zugeständnis an Russland erschien darum für den Westen in jener Zeit derart absurd, dass selbst ein Gedanke darüber nicht der Rede wert war.
Den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen war jedoch kein Erfolg beschieden und ihre Verschlechterung war zwar eine allmähliche und schleichende, aber eben keine überraschende Entwicklung. Man dachte, lebte und handelte aneinander vorbei: Angefangen bereits mit Gajdars Reformen, die der russischen Bevölkerung viel Leiden und Entbehrung abverlangten und letztlich zur gescheiterten Transformation führten, deren vorläufiger Höhepunkt im Finanzdesaster 1998 mündete, setzte sich der Entfremdungsprozess zwischen Russland und dem Westen mit dem Kosovo-Krieg fort, der in der russischen Öffentlichkeit – vom Westen völlig ignoriert – Entsetzen und Empörung auslöste.
Der Aufstieg Putins mit seiner allmählichen Abwendung vom Westen, die westliche Kritik an zwei Tschetschenienkriegen, Putins Münchener Rede (2007) usw. usf. waren deutliche Alarmzeichen, bis schließlich der Ausbruch der sog. »Ukraine-Krise« 2014, die immer noch ungelöst bleibt, das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen bzw. den USA endgültig zerrüttet und vergiftet hat.
Wäre eine andere Entwicklung als die in den 1990er-Jahren und danach stattgefundene überhaupt denkbar und möglich? Die westlich gesinnten und an die Macht gelangten Machteliten im Russland der 1990er-Jahre waren von »der« westlichen Lebenskultur genauso wie von der missverstandenen Marktwirtschaft (»рыночная экономика«)2 derart besessen, dass jeder Alternativgedanke zu einem imaginären Westen als abstrus erschien.
Auch für die vorherrschende westliche »liberale Theorie« kam alles andere als die Verwirklichung der »westlichen Werte« gar nicht in Frage. Für sie ist nicht »das Machtgleichgewicht Garant für Ordnung, sondern die Durchsetzung von Wertordnungen, die sich in liberalen Demokratien und in den Menschenrechten manifestieren«3. Diese außenpolitische »Kernvision« vor allem der US-Demokraten, deren Ursprung auf Woodrow Wilsons Bemühen, die Welt »safe for democraty« zu machen, genauso wie auf Roosevelts »Messias-Komplex« (Charles A. Beard) oder Trumans Zukunftsvision von einer »das amerikanische System« übernehmenden Welt zurückgeführt werden kann, geht von der irrigen Grundannahme aus, dass die Verfassungsform eines Staatswesens auch ihr Außenverhalten vorausbestimmt. »Die historischen Erfahrungen« – stellte Herbert Dittgen (ebd.) bereits 1996 zutreffend fest – »sprechen eindeutig gegen eine solche Behauptung.«
Die vergangenen dreißig Jahre haben diese Grundannahme nicht nur gründlich widerlegt, sondern geradezu in ihr Gegenteil verkehrt: Die »liberalen Demokratien« erkaufen ihren liberalen Frieden in der Innenwelt mit dem Unfrieden in der Außenwelt, ja der Unfriede wird oft bewusst in Kauf genommen oder gar gezielt herbeigeführt. Die eigene Sicherheit und der eigene Wohlstand gehen vor und im Zweifel zu Lasten der Außenwelt!
Vor diesem Hintergrund ist man eher geneigt, einem anderen US-Demokraten – dem Außenminister James F. Byrnes (1945–1947) – zuzustimmen, der 1949 nüchtern feststellte: »Was wir tun müssen, ist nicht die Welt für die Demokratie, sondern für die Vereinigten Staaten sicherer zu machen.«
»Warum wird« aber – fragte Lothar Brock 2007 – »das Konfliktgeschehen der Gegenwart in ganz erheblichem Maße durch die Gewaltanwendung der demokratischen Staaten bestimmt? Warum sind in den liberalen Demokratien neue Sicherheitsdiskurse in Gang gekommen, die in Verbindung mit einer Ausweitung des Konzepts der Verteidigung (Art. 54 UN-Charta) und einer verengten Interpretation des Gewaltverbots (Art. 2, Abs. 4) einer erneuten ›Enttabuisierung des Militärischen‹ … nach dem Ende des Ost-West-Konflikts Vorschub leisten?«4
Woher kommt nun in der Tat diese nach dem Ende des Kalten Krieges »urplötzlich« stattgefundene »Enttabuisierung des Militärischen«? Liegt dies vielleicht daran, dass der dem Westen im Wege stehende ideologische und geopolitische Rivale schlicht untergegangen ist und der US-Hegemon weder Hemmungen noch Skrupel mehr verspürte, auf irgendjemand Rücksicht zu nehmen, um den eignen Machtwillen durchsetzen zu können? Das wäre doch die naheliegende Antwort! Brock beantwortet hingegen die Frage ganz anders. Die infolge der veränderten geopolitischen Kräfteverhältnisse nach dem Ende des Kalten Krieges stattgefundene »Enttabuisierung des Militärischen« führt er auf die »Evolution des Völkerrechts«, nämlich auf eine Evolution »von einem Recht zur Regelung des Krieges zu einem Recht der kollektiven Friedenssicherung« (ebd., 51) zurück. Das ist aber nichts anderes als eine verklausulierte Rechtsbegründung des Westens, sich selbst zu ermächtigen, die »kollektive
Friedenssicherung« im Namen des »evolutionären Völkerrechts« notfalls militärisch zu erzwingen, da mit »Kollektiv« hier de facto (nicht de jure) nur der kollektive Westen gemeint sein kann.
Ebenso wenig dient die »Weiterentwicklung des Konzepts der Menschenrechte« zu einer »Stärkung des internationalen Schutzes der klassischen politischen Rechte« (ebd., 54); vielmehr zeigt eine solche »Weiterentwicklung« die Transformation der Nachkriegsordnung in eine vom Westen unter der Führung des US-Hegemons dominierte und als »liberal« verklärte hegemoniale Weltordnung. Diese Transformation setzt wiederum nicht nur de facto eine Ignorierung des UN-Weltsicherheitsrates als höchstem Organ der Friedenssicherung voraus, sondern auch und vor allem die Aushebelung des von den Großmächten Russland und China favorisierten absoluten Souveränitätsbegriffs, dessen Funktion einzig und allein darin besteht, die ideologische und geopolitische Einmischung der raumfremden Mächte in die inneren Angelegenheiten, zu denen in erster Linie das Herrschaftssystem gehört, zu unterbinden. »Anderenfalls hören sie auf, souveräne Staaten zu sein und werden zu Satelliten bzw. Vasallenstaaten.«5
Es war Clinton, der erneut getreu der messianischen Tradition der US-Demokraten eine Demokratisierungsoffensive zum Credo seiner Außenpolitik machte. Er ließ sich von der altbekannten Grundannahme eines Wilson, Roosevelt oder Truman inspirieren, dass »die amerikanische Sicherheit von der Demokratisierung aller Herrschaftssysteme in der Welt abhängt«6. Folgt man dieser so formulierten Prämisse der hegemonialen Universalideologie, so wird schnell aus dem Interventionsverbot der UN-Charta (dem Untergang des Sowjetimperiums sei Dank) ein Interventionsgebot.
Heute haben wir weder das europäische Gleichgewichtssystem des 19. Jahrhunderts noch die bipolare Welt der Nachkriegsordnung mit ihrem Systemwettbewerb, sondern das US-amerikanische Hegemonialsystem des 21. Jahrhunderts, legitimiert durch die universalideologische Missionierung und Propagierung der »westlichen Werte«. Ausgerüstet mit seinem »uniformierten Demokratiemodell« (Czempiel), ermächtigt der US-Hegemon sich selbst, überall und zu jeder Zeit nach Belieben und notfalls militärisch eingreifen zu dürfen.
Der Einsatz der Gewalt ist zwar nach Art. 2, Abs. 4 der UN-Charta verboten; der Hegemon rechtfertigt aber seine Selbstermächtigung mit einer Demokratieoffensive zwecks »Erhöhung der Sicherheit für alle«. »Zu ihren Gunsten Gewalt einzusetzen« – wundert sich Ernst-Otto Czempiel (ebd., 421) – »geriete zum Paradox, weil statt Sicherheit Tod und Vernichtung erzeugt werden würden«.
Das sog. »Paradox« ist allein dem Umstand zu verdanken, dass an Stelle des UN-Systems der Nachkriegsordnung das Hegemonialsystem der Nach-dem-Kaltem-Krieg-Ordnung getreten ist. Es ist darum unerheblich, ob »der Versuch, ein der westlichen Erfahrung entnommenes schematisches Modell der Demokratisierung auf der ganzen Welt durchsetzen zu wollen« »unwirksam bliebe« (ebd., 421) oder nicht. Denn die »responsibility to protect« dient weder einer imaginären »Demokratisierung« noch den Menschenrechten oder der Humanität, sondern ist ein machtpolitisches Selbstermächtigungsinstrument zwecks Durchsetzung der von der geopolitischen Opportunität geleiteten Hegemonialinteressen.
Die »responsibility to protect« geht auf eine Initiative der kanadischen Regierung zurück, »die als Reaktion auf den Kosovo-Krieg … dazu beitragen sollte, Grundsatzfragen des internationalen Schutzes der Menschenrechte in aktiven Konflikten aufzuarbeiten … Aber gerade der Anlass für diese Krise (der Kosovo-Krieg) zeigt, dass die liberalen Demokratien auf der anderen Seite selbst einen erheblichen Anteil an der ›Weltordnungskrise‹ … haben, die beide umfasst: das Völkerrecht und die UN.«7 Diese Weltordnungskrise wird allmählich auch zur Krise des ins Wanken geratenen Hegemonialsystems selbst.
Der Kosovo-Krieg offenbarte zum ersten Mal und mit aller Deutlichkeit die Folgen des Untergangs der Sowjetunion. Er war die Geburtsstunde einer neuen vom US-Hegemon geführten hegemonialen Weltordnung. Die ganze Tragweite des Transformationsprozesses von der Nachkriegsordnung in eine hegemoniale Weltordnung ging zunächst verborgen vor sich, bis die nachfolgenden, militärischen Interventionen und Invasionen ihn sichtbar werden lassen. Mit dem Kosovo-Krieg demonstrierte die NATO eindrucksvoll ihr neues Machtinstrument der sog. »humanitären Intervention«, das sich allerdings als ziemlich diffizil erwies.
Es lieferte eine Legitimationsgrundlage für den eigenmächtigen, vom Weltsicherheitsrat nicht sanktionierten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO gegen die Volksrepublik Jugoslawien, legte aber gleichzeitig ein Fundament für einen Erosionsprozess der gerade im Entstehen begriffenen hegemonialen Weltordnung.
Das neue Hegemonialsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es sich selbst im Namen der Menschenrechtsideologie legitimiert, das Gewaltverbot der UN-Charta umdefiniert und das UN-Recht ins NATO-»Völkerrecht« transformiert. Auf der Grundlage dieser Neulegitimation, Umdefinition und Transformation entstand ein hegemoniales Weltordnungssystem mit noch mehr Gewalt und Zerstörung, begleitet von zunehmenden Spannungen zwischen dem US-Hegemon und seinen geopolitischen Rivalen China und Russland. Der Kalte Krieg ist zwar zu Ende gegangen; dessen Geist weht aber nach wie vor durch die westlichen Korridore der Macht.
2. Die gescheiterte US-Interventionspolitik
Die Transformation der Nachkriegsordnung in eine hegemoniale Weltordnung zeigt sich vor allem an der Umdeutung des Gewaltverbots nach Art. 2, Abs. 4 der UN-Charta, welcher dahingehend ausgelegt wird, dass der gewaltsame Schutz der Menschenrechte den Zielen der UN-Charta nicht widerspreche und dass das Interventionsverbot einem »effektiven«, d. h. gewaltsamen Schutz der Menschenrechte nicht im Wege steht.
Die Frage nach der Nichtsanktionierung der Gewaltanwendung durch den Weltsicherheitsrat bleibt dabei unbeantwortet, es sei denn, man entwickelt eine neue völkerrechtliche Theorie. Mit einer solchen Theorie der sog. »Unterinstitutionalisierung« konstituiert Habermas 19998 eine Staatengruppe, die sich wie eine weltbürgerliche Instanz darum bemühe, die Effektivitätslücke zwischen friedenssichernden und friedensschaffenden Maßnahmen zu schließen. Habermas eröffnet mit seiner Konstruktion nach Brocks Auffassung (ebd., 56) »die Möglichkeit, den NATO-Luftkrieg vorläufig als Vorgriff auf eine angemessene institutionalisierte Ordnung zu verstehen«.
2007 durfte Brock sich noch Hoffnungen über eine solche »angemessene institutionalisierte Ordnung« machen. Heute wissen wir, dass sich diese Hoffnungen als Selbsttäuschung erwiesen haben. Mit Habermas Konstruktion wurde vielmehr der Transformationsprozess der UN-Nachkriegsordnung in eine US-amerikanische Hegemonialordnung legitimiert, das NATO-»Völkerrecht« neben der UN-Charta de facto installiert und die Gewährleistung des Weltfriedens durch den Weltsicherheitsrat relativiert. Dass dem Kosovo-Krieg Tausende unschuldige Zivilisten (man schätzt zwölf- bis dreizehntausend) zum Opfer gefallen sind, das scheint Habermas nicht zu interessieren. Freilich, die Gefallenen benötigen keine Menschenrechte mehr, ganz zu schweigen davon, dass die bewaffneten NATO-Missionare weder Demokratie noch Menschenrechte, wohl aber viel Elend und Leiden den Überlebenden mitbrachten.
»Dient heute die Berufung auf Menschenrechte« – stellte Ingeborg Maus bereits 1999 fest – »direkt der Legitimation militärischer Aktionen und wird die UN-Charta … interventionsgerecht uminterpretiert, so werden umgekehrt Menschenrechte in diesem neuen Kontext um genau die individualistische Dimension verkürzt, die ihre ursprüngliche Bedeutung ausmachte: Die militärische Intervention zum Zweck der Menschenrechte kommt als militärisch nicht umhin, gleichzeitig ganz fundamentale Menschenrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu verletzen, ohne doch die Zustimmung der betroffenen Individuen als Träger dieser Rechte einholen zu können. Menschenrechte werden so von individuellen subjektiven Rechtsansprüchen zu objektiven Systemzwecken verkehrt.«9
Mit dem Kosovo-Krieg etabliert der US-Hegemon eine hegemoniale Interventionspraxis unter Umgehung des UN-Rechts und macht die vom Völkerrecht geächteten Angriffskriege wieder salonfähig. Was aber die Salon-Menschenrechtler betrifft, so kümmern sich die Herrschaften weniger um konkrete menschliche Schicksale als vielmehr um abstrakte, blutleere »Ideale« zwecks Befriedigung ihres pseudomoralischen Gewissens.
Mit dem Kosovo-Krieg wurde die UN-Nachkriegsordnung endgültig zu Grabe getragen, indem das höchste Prinzip der UN-Charta, die kollektive Friedenssicherung, de facto auf die »Friedensschaffung« durch die vom US-Hegemon dominierte Hegemonialordnung überging. Es war nur folgerichtig vom Vorsitzenden des Beratungsausschusses beim US-Verteidigungsministerium, Richard Perle, 2002 seine »tiefe Besorgnis« darüber zu erklären, dass den Vereinten Nationen das Recht zugesprochen werde, über Krieg und Frieden zu entscheiden, wo doch diese Berechtigung mit größerer Legitimation der NATO als der Gemeinschaft demokratischer Staaten zustünde (International Harald Tribune, 28.11.2002, S. 4).10
Die Folgen der Transformation des Systems der kollektiven Friedenssicherung der UN-Charta in das System der US-amerikanischen »Friedensschaffung« sind zahlreiche militärische Interventionen und US-Invasionen in Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen, Somalia, Syrien, Jemen und nicht zuletzt ein fortwährender Drohnenkrieg überall und zu jeder Zeit in den vergangenen zwanzig Jahren. Die Opferzahlen der US-Interventionen und Invasionen nach dem 11. September 2001 wurden zwar offiziell weder erfasst noch veröffentlicht. Manche Untersuchungen beziffern sie aber auf mehrere Millionen.
Allein im Irak wird die Opferzahl auf »etwa 2,4 Millionen Menschen«11 geschätzt. In Afghanistan »liegt die Zahl der seit 2001 auf beiden Seiten getöteten Afghanen bei etwa 875.000, minimal 640.000 und maximal 1,4 Millionen« (ebd., 141). In Kombination mit Pakistan schätzt Nicolas J. S. Davies »bis Frühjahr 2018 auf etwa 1,2 Millionen getöteter Afghanen und Pakistanis durch die US-Invasion in Afghanistan seit 2001« (ebd., 142) usw.
Zwar wurden mehr als 150 größere bewaffnete Konflikte zwischen 1947 und 1991 mit schätzungsweise bis zu 20 Millionen Opfern ausgefochten.12 Die Gründe für diese Konflikte sind aber ursprünglich der von der Blockkonfrontation zwischen Ost und West geprägten Nachkriegsordnung zu verdanken, die vom ideologischen und geopolitischen Gegensatz der USA und der UdSSR dominiert wurde.
Die auf »Humanität«, »Demokratie« und »Menschenrechte« gegründete »heile« Welt der hegemonialen Weltordnung ist allerdings eine ganz andere »neue« Form der »friedlichen« Koexistenz der vom US-Hegemon wieder zum Leben erweckten monströsen Anti-Moderne13. Das ist lediglich der Anfang einer leidvollen Geschichte des 21. Jahrhunderts, welches das erbarmungslose 20. Jahrhundert womöglich noch in den Schatten stellen wird.
Der liberale Friede in der innerwestlichen Welt wird mit Chaos, Verwüstung, Verelendung und Zerstörung der außerwestlichen Welt erkauft. Die geschundene Außenwelt lässt freilich die westliche Welt nicht in Ruhe und kommt wie ein Bumerang rachedurstig immer wieder und immer öfter mit Attentaten, Terror und Zerstörung in den Westen zurück, um dessen »heile Welt« auch leidend sehen zu können.
Je elender das Innenleben der Außenwelt wird, umso strahlender erscheint der westliche Stern am geopolitischen Himmel, umso höher ist die Anziehungskraft des Westens, umso mehr strömen alle Geschundenen dieser Erde in das »gelobte Land«, um von den »westlichen Werten« nicht nur zu hören, sondern diese auch hautnah miterleben zu dürfen, und umso »prominenter« wird auch die Rolle des Westens »im Gewaltgeschehen der Gegenwart«14.
Aus diesem Teufelskreis kommt der Westen nicht mehr raus, es sei denn, er transformiert freiwillig die selbstgeschaffene hegemoniale Weltordnung in eine andere deeskalierende Weltordnung, womit freilich nicht zu rechnen ist.
Um der entstandenen Chaoswelt einen Schein der Legalität zu verpassen, beansprucht der Westen unter Führung des US-Welthegemons wie selbstverständlich eine völkerrechtliche Deutungshoheit für sich, die zwar seinem hegemonialen Selbstverständnis entspricht, nichtsdestoweniger aber im eklatanten Widerspruch zum Gewaltverbot der UN-Charta steht. Die eigenmächtige, normative Umdeutung des UN-Rechts sucht der Westen gleichzeitig derart flexibel zu handhaben, dass er nicht einmal die Selbstbindung an die eigene Rechtsauslegung zu akzeptieren gewillt ist. Die hegemoniale Weltordnung beansprucht schlicht ein freies Ermessen selbst zur Rechtsauslegung der eigenen Selbstermächtigung. Das ist gelinde gesagt eine pure Machtwillkür der sich selbst legitimierenden Hegemonialordnung.
Die Selbstlegitimation führt wiederum dazu, dass die vom Westen vorangetriebene Entwicklung neuer Verhaltensnormen und Spielregeln in den internationalen Beziehungen – die sog. „regelbasierte Ordnung“ – eine universale Geltung beansprucht, »ohne sich jedoch in gleicher Weise auf die Schaffung von Verfahrensregeln für die Umsetzung dieser Normen im Rahmen des UN-Systems einzulassen« (ebd.), was nichts anderes als die typische Vorgehensweise einer Hegemonialmacht ist, welche die anderen Staaten und Nationen dazu verpflichtet, sich an Verträge und Vereinbarungen genauso wie an Verhaltensnormen und Spielregeln zu halten, ohne sich selbst daran binden zu lassen. Nach innen liberal, nach außen hegemonial: Das ist wohl der Motor der neuen vom US-Hegemon dominierten Weltordnung.
Ein solcher Zustand der internationalen Beziehungen gefährdet den Weltfrieden, weil er eben kein Friedenszustand mehr ist, sondern ein Naturzustand (status naturalis), »der vielmehr ein Zustand des Krieges ist, d. i. wenn gleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, (so) doch immerwährende Bedrohung mit denselben« (Immanuel Kant). Diese »immerwährende Bedrohung« charakterisiert eben den aktuellen Zustand der entstandenen hegemonialen Weltordnung als »einen Zustand des Krieges«.
Deutet man nun die geopolitische Entwicklung der Gegenwart mit Lothar Brock (ebd., 66 f.) als eine »ungleiche Entwicklung«, die »für internationale Machtdisparitäten« steht, weil sie auf einer »zivilisatorischen Differenz … zwischen liberalen Gesellschaften, ›ordentlichen Mitgliedern einer vernünftigen Gemeinschaft wohlgeordneter Völker‹ und ›outlaw-Staaten‹» beruht, dann erinnert diese auf einer »zivilisatorischen Differenz« beruhende Entwicklung vollends an die »ehrwürdige« Unterscheidung zwischen »Herrenrasse« und »Untertanenrasse«, über welche Herrschaft ausgeübt werden soll.
Hegemonial gewendet, dürfte diese »Erkenntnis« wohl heißen: Die völkerrechtliche Deutungshoheit und die Schaffung neuer Spielregeln der internationalen Beziehungen obliegt ausschließlich dem Hegemonialsystem der zivilisierten »Gemeinschaft wohlgeordneter Völker«, das allein befugt ist, die »Herrschaft über Untertanenrassen« (Lord Cromer) auszuüben. Oder in der Terminologie der amerikanischen Neocons formuliert: Die unzivilisierten »Rogue States« benötigen Zwangsmaßnahmen seitens der »liberalen Demokratien« zur Durchsetzung der von ihnen festgeschnürten universalen Standards.
Diese US-amerikanische Interventionspolitik ist mit dem Abzug der US-Truppen aus dem Afghanistan im Sommer 2021 grandios gescheitert. Die „neue“ Geostrategie der Biden-Administration lautet heute: Eine verschärfte ideologische und geoökonomische Konfrontation gegen die alten geopolitischen Rivalen Russland und China. Ob diese »neue« Geostrategie erfolgreicher als die gescheiterte Interventionspolitik sein wird, bleibt indes mehr als zweifelhaft.
3. Das Symbol des Scheiterns: Die Ukraine-Krise
Die seit 2014 ausgebrochene und immer noch andauende Ukraine-Krise hat zu geopolitischen Spannungen und zur Entfremdung zwischen Russland und dem Westen geführt. Sie hat aber gleichzeitig den Schlussstrich unter den zahlreichen russischen Versuchen gezogen, sich in die euro-atlantischen Strukturen zu integrieren bzw. ein Teil des „erweiterten Westens“ zu werden.
Bereits die sogenannte Orange-Revolution von 2004, die aus der Sicht der USA und des Westens geostrategisch (noch) erfolglos geblieben ist, wird nun mit Euromaidan 2013/2014 endgültig(?) von Erfolg gekrönt sein. Das Euromaidan-Ereignis (ob es ein „Staatsstreich“ oder eine „Revolution“ gewesen sein soll, sei dahingestellt) war wahrlich eine dramatische geostrategische Raumverschiebung zu Lasten der bis dahin seit Jahrhunderten dominierenden russischen Raummacht, weil eben die Ukraine den endgültigen(?) Bruch mit Russland vollzogen hat, indem sie sich geostrategisch von ihm abgewandt und dem Westen zugewandt hat.
Das Euromaidan-Ereignis ist aus der Sicht eines liberalen Verfassungsstaates keine liberal-demokratische Revolution gewesen, wie die Meinungsmacher im Westen uns weismachen möchten. Vielmehr ist es bis zum heutigen Tage das geblieben, was es seiner Natur nach von Anfang an war: die weitreichendste, geostrategische Zäsur seit Jahrhunderten, welche die Einheit des ostslawischen
Machtraumes zu Lasten der bis dahin dominierenden, russischen Raummacht und zu Gunsten der westlichen, raumfremden Mächte sprengte. Diese als „liberal-demokratische Revolution“ verklärte geostrategische Niederlage Russlands kann man darum getrost und ohne Übertreibung als die geopolitische Revolution historischen Ausmaßes charakterisieren. Da erscheint die Krim-Eingliederung in die Russländische Föderation lediglich als Trostpflaster, das die bittere geostrategische Niederlage Russlands nur kaschiert, aber nicht beseitigt. Keiner weiß heute, welches „geopolitische Risiko“ sich noch dahinter verbirgt.
Die Krim-Eingliederung war aus der russischen Sicht nicht nur ein geopolitisches Minimum, welches das gestörte, geostrategische Gleichgewicht etwas abmildert, aber nicht aufhebt, sondern auch und in erster Linie eine Präventivmaßnahme. Sie trug darum einen rein defensiven, aber keinen expansiven Charakter. Diese Feststellung bedarf einer Erläuterung. Auf der Krim bestand nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems von Anfang an eine „Doppelherrschaft“ (dvoevlastije). De facto (militärisch und demographisch) war die Krim in der Hand der Russen, de jure bzw. völkerrechtlich aber im Besitz der Ukraine.
Mit der Krim-Eingliederung in die Russländische Föderation wurde die „Doppelherrschaft“ 2014 abrupt beendet. Diese Vorgehensweise der russischen Führung war aus ihrer Sicht geboten, um dem geopolitischen Gesetz des Handelns gerecht zu werden, das da lautet: Im globalen Raum existiert weder ein geopolitisches Niemandsland noch ein geostrategisches Vakuum. Die Geopolitik duldet kein Vakuum. Man mag diese Tatsache beklagen, ändern lässt sie sich nicht. Ist es – warum auch immer – entstanden, wird es sicherheitspolitisch früher oder später beseitigt. Schon die bloße Gefahr einer weiteren Expansion der raumfremden Mächte erfordert die Beseitigung des geopolitischen Vakuums. „Abwarten und Tee trinken“ garantieren nicht nur keine Sicherheit, sondern reizen zum Angriff.
Die Ost-Erweiterung der NATO nach der Auflösung des Warschauer Paktes war der beste Beweis dafür. Die USA und ihre Verbündeten haben nach dem Ende des Kalten Krieges alles getan, um ihre Einflusssphären nicht nur friedlich, etwa über die Erweiterung der EU, sondern auch „mit einer globalen Ausweitung des Stützpunktsystems, der Entwicklung von Generationen hochmoderner Waffen und einer Reihe von völkerrechtswidrigen Kriegen, von Kosovo über den Irak bis Libyen“, auszudehnen. „Der militärisch gestützte Regimewechsel ist seit 1995 zu einem Kennzeichen westlichen Außenpolitik geworden. Möglich war das nur aufgrund der großen wirtschaftlichen und militärischen Übermacht des Westens.“15
Als die russische Führung 2014 verstand, dass sie in der Ukraine eine schwere geostrategische Niederlage erlitten hat, handelte sie nicht zuletzt aus der Erfahrung mit der NATO-Expansion gen Osten umgehend, um das entstandene geostrategische Vakuum nicht schon wieder seinem geopolitischen Rivalen zu überlassen. Die von Jeffrey Goldberg („The Obama Doctrine“, in: The Atlantic, April 2016) kolportierte Äußerung Obamas, der „Moskaus Verhalten in der Ukraine-Krise“ als „eine improvisierte Reaktion auf den bevorstehenden Ausbruch eines Klientelstaates aus dem Einflussbereich Russlands“ diagnostizierte, scheint vor diesem Hintergrund zwar plausibel, aber nur teilweise zutreffend zu sein. Zutreffender ist da schon Henry Kissingers Feststellung, Sicherheit habe für Russland „immer auch eine geopolitische Grundlage“16. Was bedeutet aber diese sogenannte „geopolitische Grundlage“ genau?
Wenn Hans–Henning Schröder einerseits zu Recht feststellt, dass die russische Führung bis 2014 „defensiv agierte“ und sich „auf den eigenen Nachbarschaftsraum“ konzentrierte, andererseits aber die „Krise russischer Außenpolitik 2013-2014“ diagnostiziert, in deren Folge sich „die Putinsche Führung (entschied), in die Offensive zu gehen“, um die Krim gewaltsam zu „annektieren“, ohne „auf die Regeln der europäischen Sicherheitsordnung . . . Rücksicht“ zu nehmen17, dann verkennt er nicht nur komplett das geopolitische Gesetz des Handelns und folgerichtig einen defensiven Charakter der russischen Vorgehensweise, sondern auch die sicherheitspolitische Bedeutung der Halbinsel Krim für die Russländische Föderation.
Die Krim-Eingliederung in die Russländische Föderation war – rein geostrategisch betrachtet – keine „Annexion“, sondern Prävention. Die geoökonomische Bedeutung des Schwarzmeer-Raumes hat Peter B. Struve für Russland schon Anfang des 20. Jahrhunderts mit Nachdruck hervorgehoben und bereits 2004 haben Ronald D. Asmus und Bruce P.Jackson dessen geopolitischen Stellenwert für den Westen erneut in Erinnerung gerufen18. Und wenn Schröder (ebd., 19) im gleichen Atemzug dem russischen Außenminister Sergej Lavrov vorwirft, er lasse für Russland die international gültigen Normen, „wie sie z. B. in der UN-Charta festgeschrieben sind“, nicht mehr gelten, dann ist dieser Vorwurf zum einen in Anbetracht der westlichen Interventionspolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte wohlfeil und zum anderen verwechselt Schröder Geopolitik mit Völkerrecht. Er befindet sich hier durchaus in guter
Gesellschaft, welche die Geopolitik als einen integralen Bestandteil des Völkerrechts missversteht und folgerichtig verwundert fragt: „Wie passen nun diese widersprüchlichen und verwirrenden Tendenzen des Völkerrechts zusammen: einerseits die Tendenz zur Konstitutionalisierung der internationalen Gemeinschaft auf der Grundlage der souveränen Gleichheit aller Staaten, andererseits die zweifache Durchbrechung des Gleichheitsprinzips zum einen zu Gunsten von Großmächten, zum anderen zu Lasten von Außenseiterstaaten?“19 Die beiden Tendenzen passen in der Tat nicht zusammen und sie haben auch keinen „inneren Zusammenhang“, weil sie eben parallel nebeneinander laufende, voneinander unabhängige normative Quellen haben und miteinander erst in Berührung kommen, wenn es darum geht, die geopolitischen Zielvorhaben völkerrechtlich zu verklären.
In der Geopolitik gilt eben eine andere Art der Normativität, die – um mit Georg Jellinek zu sprechen – auf der „normativen Kraft des Faktischen“ und nicht auf den völkerrechtlichen Normen der UN-Charta beruht. Die Geopolitik erhebt das Faktische zum Normativen und erzeugt dadurch die Vorstellung, dass das Faktische normativer Art ist, wobei es hier nicht um eine Gegenüberstellung von Faktizität und Normativität, sondern um eine andere, geopolitische Quelle der Normativität geht. Diese Quelle der geopolitischen Normativität besagt: Wer sich gegen den Aufmarsch des geopolitischen Rivalen nicht zu behaupten vermag, verliert nicht nur seine Autorität, sondern auch seine geopolitische Existenz, was wir gerade im Falle der Ukraine beobachten dürfen. Die Ukraine errang zwar endgültig ihre völkerrechtliche Souveränität, verlor aber gleichzeitig ihre geopolitische Existenz. Der Ausgang dieser Entwicklung bleibt bis auf weiteres offen.
Die eventuelle Gefährdung der eigenen geopolitischen Existenz impliziert eine Tendenz, die zukünftige Entwicklungen vorwegnehmen zu müssen, d.h. die Tendenz zum präventiven Handeln. Und genau diese präventive Vorgehensweise auf der Krim (die Vertreter des russischen außenpolitischen Establishments sprechen in diesem Zusammenhang von der „roten Linie“) wird von westlichen Meinungsmachern als „expansionistisch“, „revanchistisch“ und „aggressiv“ denunziert. Diese Denunziation des geopolitischen Rivalen ist allerdings alles anderes als eine Glanzleistung der westlichen Russlandpolitik und Russlandforschung, welche die russische Reaktion im Vorfeld der „Ukraine-Krise“ gar nicht auf ihrer Rechnung hatten und daher die erfolgte Prävention im Nachhinein völlig falsch einschätzten. Das sollte den sogenannten „Russlandexperten“ in der Forschung und Politik eigentlich eine Lehre sein! Doch was haben sie daraus gelernt? Nichts! Die westliche Russlandpolitik und Russlandforschung haben bis heute nichts gelernt und nichts verstanden.
Dieser Unbelehrbarkeit steht im Wege sowohl der fortgesetzte, außenideologisch bestimmte Anspruch des Westens auf seine axiologische Weltdominanz im Allgemeinen als auch die Machtarroganz der USA im Besonderen. Im Glauben, die geopolitische Agenda immer noch weltweit diktieren zu können, betreiben die USA mit ihrer Eskalationsdominanz ein gefährliches, weil friedens- und lebensgefährdendes Spiel. Da möchte man immer wieder und immer öfter dem US-Hegemon mit Goethe zurufen:
»Wer mit dem Leben spielt, kommt nie zurecht;
Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer ein Knecht«
und der Gefangene seiner Selbstüberschätzung.
Anmerkungen
1. Dittgen, H., Das Dilemma der amerikanischen Außenpolitik: Auf der Suche nach einer neuen Strategie, in: Dittgen, H./Minkenberg, M. (Hrsg.), Das amerikanische Dilemma. Die Vereinigten Staaten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Paderborn 1996, 291-317 (292).
2. Siehe Silnizki, M., Geoökonomie in Russland. Gajdar und die Folgen. Berlin 2020.
3. Dittgen (wie Anm. 1), 296 f.
4. Brock, L., Universalismus, politische Heterogenität und ungleiche Entwicklung: Internationale Kontexte der Gewaltanwendung von Demokratien gegenüber Nichtdemokratien, in: Geis u. a. (Hrsg.), Schattenseiten des Demokratischen Friedens. Frankfurt/New York 2007, 45-68 (46).
5. Czempiel, E.-O., Intervention, in: Kaiser, K./Schwarz, H.-P. (Hrsg.), Die neue Weltpolitik. Bonn 1995, 418-425 (418 f.).
6. Ebd., 419.
7. Brock (wie Anm. 4), 54.
8. Näheres dazu Brock (wie Anm. 4), 56.
9. Maus, I., Der zerstörerische Zusammenhang von Freiheitsrechten und Volkssouveränität in der aktuellen nationalstaatlichen und internationalen Politik (1999), in: ders., Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie. Berlin 2011, 359-374 (361).
10. Zitiert nach Müller, H., Die Arroganz der Demokratien. Der »Demokratische Frieden« und sein bleibendes Rätsel, in: Wissenschaft & Frieden 2 (2003).
11. Davies, Nicolas J. S., Die Blutspur der US-geführten Kriege seit 9/11: Afghanistan, Jemen, Libyen, Irak, Pakistan, Somalia, Syrien, in: Mies, U. (Hrsg.), Der tiefe Staat schlägt zu. Wie die westliche Welt Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet. Wien 22019, 131-152 (132).
12. Vgl. Greiner, B., Kalter Krieg und »Cold War Studies«, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010, 1-9 (2).
13. Silnizki, M., Anti-Moderne. US-Welthegemonie auf Abwegen. Berlin 2021.
14. Brock (wie Anm. 4), 66.
15. Pradetto, A., Die Krim, die bösen Russen und der empörte Westen, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 5 (2014), 71-78 (71).
16. Henry Kissinger in einer Rede in Moskau (abgedruckt in: The National Interest, 4.2.2016). Zitiert nach Peter Rudolf, Amerikanische Russland-Politik und europäische Sicherheitsordnung. SWP-Studie, September 2016, 1-28 (28).
17. Schröder, H-H., Großmacht und Geschichte, in: Russland-Analysen, Nr. 314, 22.04.2016, 16-20 (16 f.).
18. Струве, П. Б., «Великая Россия». Из размышлений о проблеме русского могущества, в: Русская мысль 1908, 143-157: «Основой русской внешней политики должно быть . . . экономическое господство России в бассейне Черного моря. Из такого господства само собой вытечет политическое и культурная преобладание России на всем так называемом Ближнем Востоке»; Asmus, R. D./Jackson B. P., Eine Strategie für den Schwarzmeer-Raum, in: Internationale Politik 6 (2004), 75-86.
19. Preuß, U. K., Souveränität – Zwischenbemerkungen zu einem Schlüsselbegriff des Politischen, in: Stein, T. u.a. (Hrsg.), Souveränität, Recht, Moral. Die Grundlagen politischer Gemeinschaft. Frankfurt/New York 2007, 313-335 (331).